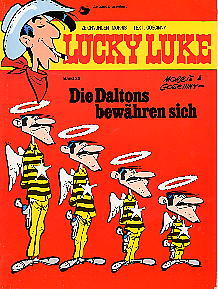Neulich blieb ich an diesem Satz von Franz Jaliczs hängen:
Es ist der selbstverständliche Wunsch eines Christen, dass Jesus Christus von allen Menschen anerkannt werde. Dieser Wunsch kann aber ein Hindernis sein, die persönliche Bedeutung der Äußerungen zu erfassen, falls sie von diesem Wunsch abweichen oder dazu im Widerspruch stehen.
und etwas später schreibt er (Miteinander im Glauben wachsen, S. 47/49):
Wer seinen Glauben mit der Überzeugung mitteilen möchte, dass er über einen Schatz verfügt, den der andere nicht oder noch nicht in demselben Maß besitzt, kann auf einen inneren Widerstand stoßen, wenn er mit seinem Gesprächspartner auf gleicher Stufe sprechen möchte.
Ich habe mich dann gefragt, ob man den Begriff der Absichtslosigkeit aus der Tradition des kontemplativen Gebets übertragen kann auf die Haltung, die man auch in einem Glaubenskurs (das war der Grund, warum ich das nachlas) anderen Menschen gegenüber pflegen sollte. Aber es gibt ja auch immer die, für die „offen für alles“ automatisch „nicht ganz dicht“ bedeutet.
Also: Kann ich meine Überzeugung schon dadurch verraten, dass ich sie einem anderen nicht aufschwatze?
Absichtslosigkeit beim Beten bedeutet ja nicht, dass ich nicht beten will, sondern dass ich nicht auf ein ganz bestimmtes Resultat festgelegt bin. Wie es kommt, so ist es in Ordnung. Ähnlich im Alpha-Kurs: Ich bringe mich in das Gespräch und den Kurs ein, ich interessiere mich für mein Gegenüber um seiner selbst willen. So wie mir beim Beten Gott konkurrenzlos wichtig ist, und ich ihm keine Vorgaben mache, wie er diese Zeit zu füllen hat, damit es sich für mich lohnt, so kann ich auch in ein Gespräch mit anderen hineingehen. Es hat seinen Wert in sich.
Pah, höre ich jetzt schon den Einwand, Reden um des Redens willen ist verschwendete Zeit, dafür sind wir nicht auf der Welt.
Ist das so?
Wenn ich absichtslos zuhöre und mich mitteile, ist schon etwas herausgekommen. Wenn ich aber unausgesprochen ein bestimmtes Resultat zur Bedingung mache, dann steigt automatisch die Wahrscheinlichkeit, enttäuscht zu werden – und die Gefahr, dass ich mich beim nächsten Mal erst gar nicht mehr auf das Beten oder auf ein weiteres Gespräch einlasse. Und dann kann gar nichts mehr passieren.
Absichtslosigkeit ist auch nicht bloße Pflichterfüllung. Wo ich etwas nur abhaken will, bin ich schon nicht mehr bei der Sache. Absichtslosigkeit ist nicht mit Gleichgültigkeit und Wurstigkeit zu verwechseln. Sie hat aber alles mit Liebe zu tun. Und darum lohnt es sich, ein bißchen Übung zu investieren.