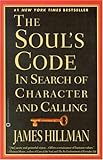Als sich unsere Gemeinde in den Anfangsjahren in einer Schulaula traf, die Band noch lauter und vielleicht auch nicht immer so gut wie heute spielte, kam ein Kirchenvorsteher aus dem Umland zu Besuch, um sich mal umzusehen. Seine Tochter erzählte mir später, er habe daheim gesagt, das sei kein Gottesdienst, was wir da machen. Der Grund war auch schnell ausgemacht: Es gab kein Vaterunser. Vor ein paar Monaten ist mir dasselbe bei einem Open Air Gottesdienst hier im Wohngebiet wieder passiert, da war es ein Herr aus der Nachbarschaft, der die Unterlassung vorwurfswoll kommentierte.
Später haben wir jeden ersten Sonntag im Monat einen Gottesdienst in einer Kneipe angefangen, und da waren es dann weniger die Gäste (die in der Regel ganz froh waren, dass es sich von dem, was sie mit „Gottesdienst“ assoziierten, wohltuend unterschied), sondern ein Teil unserer Gemeinde, der mit dieser neuen Form seine Mühe hatte. Immer wieder fiel am Monatsende der Satz, so beiläufig, dass man spürte, wie tief dieses Urteil sitzen musste: „Am nächsten Sonntag ist ja kein Gottesdienst“.
Das fehlende Vaterunser spielte dabei wohl keine Rolle. Aber solche Dinge wie: Bei einem Gottesdienst steht kein Bier oder Cola auf dem Tisch, zu einem Gottesdienst gehört eine „Lobpreiszeit“, ein Gottesdienst braucht eine bestimmte religiöse Sprache und einen sakralen Raum. Auf der anderen Seite: Im ersten Jahr besuchte uns Prof. Manfred Seitz, der in Erlangen lange Jahre praktische Theologie gelehrt hat, und bestätigte im anschließenden Gespräch, dass alle wesentlichen Elemente der Liturgik, die einen christlichen Gottesdienst konstituieren, enthalten waren.
Was also macht einen Gottesdienst aus? Die Frage wird immer drängender, wenn Christen ihre Selbstisolation überwinden wollen. Es ist vielleicht nicht die lateinische Messe nach tridentinischem Ritus wie bei den Piusbrüdern, aber andere alte und neue Traditionen (indem man etwa Latein durch einen der verschiedenen kanaanäischen Dialekte ersetzt), die letztendlich doch Nebensächliches zur Hauptsache machen. Zu Zeiten der Christenverfolgung war es ja durchaus sinnvoll, sich zu Zeiten und an Orten zu treffen, wo es niemand bemerkte. Heute dagegen ist die (in vielen Köpfen kaum auszurottende) Prämisse, ein „richtiger“ Gottesdienst finde am Sonntag vormittag statt, ein Hauptgrund, warum viele junge Leute und alle, die den sonntäglichen Kirchgang nicht von klein auf gelernt haben, sich dort nicht bereitwillig einfinden – ganz egal, wie viel Mühe wir uns mit der Gestaltung machen.
In der Suche nach neuen Formen von Gemeinde und Gottesdienst ist es also entscheidend, dass wir möglichst sauber unterscheiden lernen, was die (wenigen) Essentials sind und was alles variabel gestaltet werden kann, weil es sich „nur“ um unsere (manchmal sehr zählebigen) Vorlieben und Gewohnheiten handelt.
Beim Einkaufen heute war der Supermarkt, wo ich Stammkunde bin, umgeräumt. Nichts war mehr am gewohnten Platz. Ich habe dreimal so lange gebraucht wie sonst und es war anstrengend. Ich fühlte mich fremd und musste mich zur Hühnerbrühe durchfragen, die ich vorher im Schlaf gefunden hätte. Sie war natürlich am anderen Ende des riesigen Schuppens.
Aber es war immer noch ein Supermarkt…