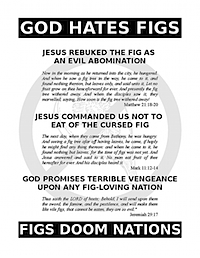Ein Dauerthema dieses Blogs ist die Frage, wie Christen in einer pluralistischen Gesellschaft dem Evangelium entsprechend leben können. Insofern sind Fanatismus und Toleranz zwei Begriffe, die ständig am Horizont erscheinen. Ob es sich um Kreuze und Kopftücher handelt, Sarrazin und die Integration, islamistischen Terror und westliche Reaktionen, Ökumene, Umgang mit Homosexualität und vieles mehr.
Hier vernünftige Grenzen zu ziehen und Unterscheidungen zu treffen ist wichtig – und folgenreich. Hin und wieder benutzen wohlmeinende Zeitgenossen dabei hochbrisante Argumentationsmuster. Vielleicht kann das auch gar nicht ausbleiben, wenn man sich auf dieses zerklüftete Terrain begibt. Trotzdem ist es gut, wenn man das Risiko wenigstens ahnt.
Wenn ich also im Folgenden ein paar Stichworte aus Hubert Schleicherts Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren aufgreife, dann kann man das im Blick auf christlichen Fundamentalismus hören (den gibt es seltener in einer echt militanten, häufiger in einer dogmatischen Variante, die allerdings auch handfeste politische Konsequenzen hat), man kann es aber auch im Blick auf islamische Hardliner, dogmatischen Atheismus wie Christopher Hitchens oder, um einmal ein ganz anderes Beispiel zu wählen, auch mal im Blick auf die Diskussion, wie eine Demokratie mit Neonazis und anderen Verfassungsfeinden umgehen soll.
Keines dieser Argumente, sagt Schleichert, ist in sich rundweg falsch oder kategorisch abzulehnen. Er exerziert es zudem am Beispiel von Calvin und Augustinus vor, nicht weil die besonders böse Menschen waren, sondern weil es lange genug her ist, so dass niemand sich sofort auf den Schlips getreten fühlen muss.
Da ist zunächst das Gefährdungsargument: der Häretiker (oder Abtrünnige/Andersdenkende) wendet sich gegen die Wahrheit, die ihm bereits klar vor Augen stand. Dass das größeren Anstoß erregt, als wenn jemand den Glauben (egal an was genau) schlicht ignoriert oder missversteht, liegt auf der Hand. Es stellt, so Schleichert, „die innere Wirksamkeit der christlichen Doktrin in Frage“ (S. 70). Nur mal so: Nach 1945 Nazi zu sein ist schlimmer als vorher – oder?
Spannend ist in diesem Zusammenhang auch das folgende Zitat aus neuerer Zeit von Karl Rahner – es wäre interessant zu wissen, ob sich kirchliche Sektenbeauftragte heute darauf noch beziehen:
Wer für den unmittelbar tödlichen Ernst einer Entscheidung darüber, ob dieser oder jener Satz wahr ist, keinen Sinn hat, der kann die christliche Einschätzung der Häresie nicht verstehen. […]. Denn hier wird die absolute Wahrheit, die schon in geschichtlich eindeutiger Weise ausgesprochen gegeben war, verloren […].
Das Heidentum […] bedeutet keine Gefahr für den Christen, der sich schlicht als weitergekommen, überlegen […] ansehen kann. Aber all das ist anders beim Häretiker: […] er verlässt das Ziel und gibt dabei vor, es allein zu besitzen. Ihm Gutgläubigkeit zuzubilligen, fällt daher dem Christentum schwerer als dem […] Ungläubigen gegenüber […]. Wie sollte er schuldlos […] das richtige und das gefälschte Christentum nicht auseinanderkennen? Er ist der Gefährlichste: er bekämpft die wirkliche und endgültige Wahrheit.
Es folgt das Hirtenargument, das bei Augustinus klassisch so lautet: Wer seinen Freund in einem Anfall von Fieberwahn auf einen Abgrund zulaufen sähe, würde ihn auch mit allen Mitteln davon abhalten, sich hinunterzustürzen: „Wer einen Tobsüchtigen bindet und einen Schlafsüchtigen aufrüttelt, fällt beiden lästig und liebt doch beide.“ Zugleich muss der verantwortungsvolle Hirte aber noch einen Schritt weitergehen, und darf die Wölfe zum Schutz der Herde nicht schonen.
Repression (lassen wir die Mittel einmal offen) wird gerechtfertigt gegen den Hinweis, dass sie noch lange bzw. an sich kein Umdenken bewirkt, sondern höchstens Heuchelei. Man kann auch an Guantanamo denken, wenn Schleichert hier Beza (er nennt ihn seltsamerweise Bezelius) zitiert mit den Worten aus de haereticis: „Nicht um von ihnen gewaltsam (…) falsche Reue zu erzwingen (werden Häretiker gestraft), sondern damit die Obrigkeit wahrhaft Gott dient (…) und die öffentliche Ordnung, die Lehre und die Sitten bewahrt bleiben.“
Das Gute rechtfertigt für Augustinus auch extreme Mittel: „Die Schläge des Freundes sind besser als die Küsse des Feindes“, das wusste schon Salomo (Spr 27,6). Zwang, der zum Guten dient, ist also etwas ganz anderes als Zwang zum Bösen. Folglich ist Gewalt gegen rechtgläubige Märtyrer qualitativ anders als Gewalt gegen Gotteslästerer. Das würden ein paar Millionen Muslime im Blick auf Kurt Westergaard vielleicht ähnlich sehen. Manche von ihnen verstehen womöglich auch
Toleranz als Ausdruck von Schwäche. Calvin etwa lehnte es ab, dem Beispiel des Gamaliel zu folgen (Apg. 5,34ff), denn dessen Zögern habe nur darauf beruht, dass er zweifelte und daraus die irrige Schlussfolgerung zog, man müsse Gott das Urteil überlassen, so würde sich das Gute von selbst durchsetzen. Manche Polemik gegen „liberale Theologie“ folgt ja derselben Spur: „Wenn die nichts mehr glauben, brauchen sie auch nichts zu verteidigen.“
Beliebt ist auch die Kriminalisierung. Dann wird der Andersdenkende zum Gotteslästerer, seine Theologie zur Blasphemie, er wird als Klassenfeind, Spion oder Kollaborateur verdächtigt. Der Homosexuelle wird zum wahrscheinlichen Kinderschänder, der Loveparade-Besucher zum schamlosen Lüstling, der Nazi per se als so dumm, zurückgeblieben oder geisteskrank hingestellt, dass man ihn zum Schutz der Allgemeinheit wohl doch besser wegsperren sollte. Nur um nicht falsch verstanden zu werden: Bei Neonazis und ihren Organisationen kommen wir tatsächlich kaum umhin, zu fragen, wo die Grenze zur kriminellen Vereinigung überschritten wird. Nur liegt die Dämonisierung anderer auch nicht weit von der Kriminalisierung weg, und die gibt es im frommen Spektrum viel häufiger.
Ein anderer Aspekt sind Denk- und Zweifelsverbote. Ob der Begriff in der Sarrazin-Debatte angebracht war, darüber kann man streiten. Calvins Opus gegen die Irrlehrer schließt mit einer Verwünschung ihrer „viehischen Spitzfindigkeiten“ – folglich erscheint ihm auch schon der suspekt, der Milde für die Abweichler fordert. In manchen christlichen Kreisen betrifft das Denkverbot die Evolutionslehre oder die Frage, wie eng man die Inspiration der Schrift zu verstehen hat, oder man verbietet den Widerspruch gegen bestimmte kanonische Autoritäten und sanktioniert das entsprechend.
Zum Schluss nennt Schleichert noch das Distanzierungargument: Der Rechtgläubige verfolgt den Häretiker nur aus Pflicht und aus Liebe, und nicht aus Selbstgerechtigkeit oder weil ihm das klammheimlich Spaß macht und Genugtuung verschafft. Solche Leute gibt es auch, aber mit denen hat der Gerechte nichts zu tun. Aktuell könnte man folgern: Es gibt Leute, die wollen muslimische Einwanderer aus dem Land oder aus der Öffentlichkeit bzw. den Sozialkassen verbannen (oder zur Assimilation drängen), weil sie Angst haben, oder neidisch sind, oder einen Sündenbock brauchen. Andere tun das aus tiefer, selbstloser Sorge um das Gemeinwohl.
So weit der spärlich kommentierte Überblick. Über die Folgen mache ich mir noch Gedanken, lese weiter und melde mich dann wieder an dieser Stelle. Wem langweilig ist oder wer das Thema vertiefen möchte, kann hier einen anregenden Artikel von John Milbank über Christentum, Aufklärung und Islam lesen