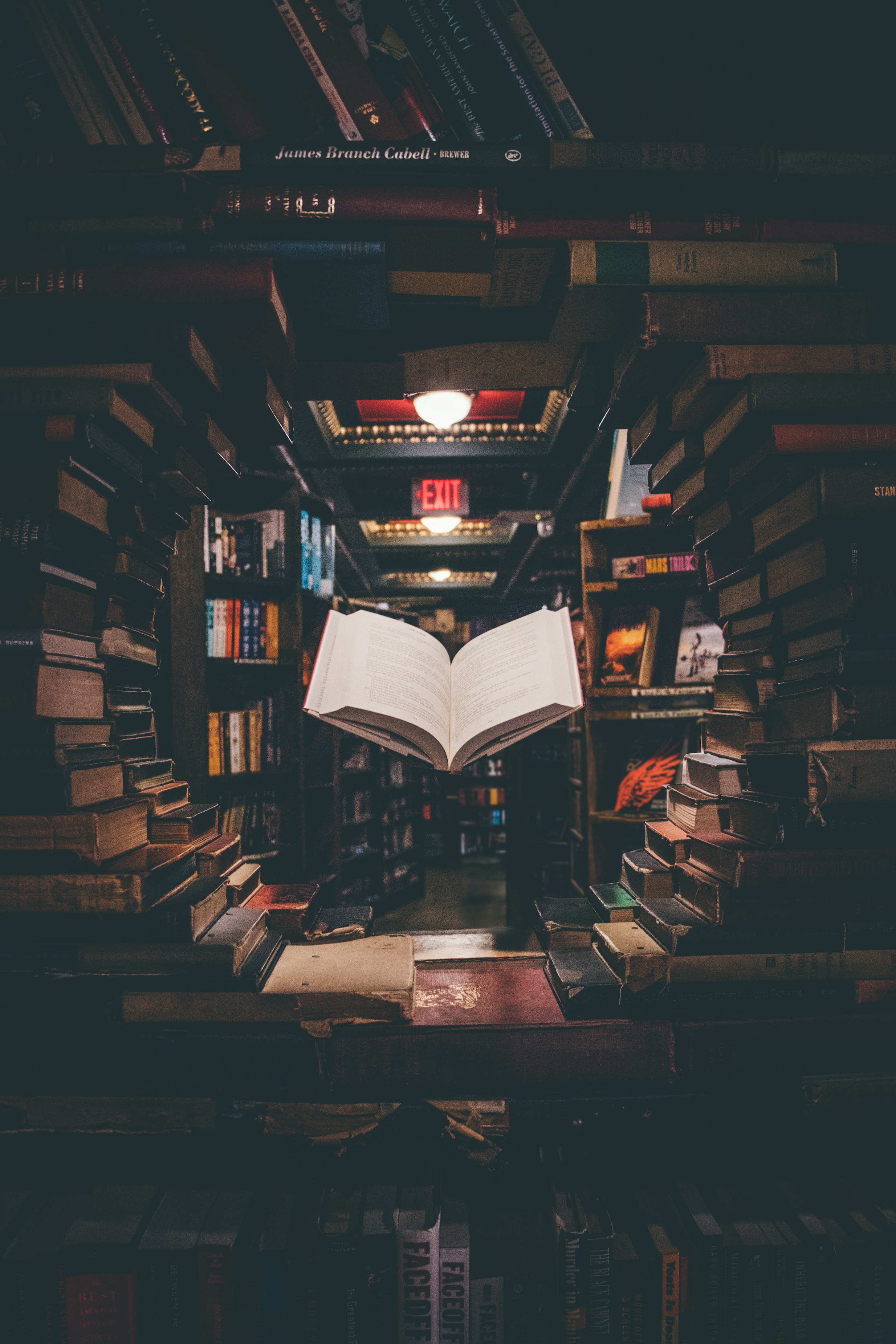Wir Stadtmenschen erhaschen nur ganz selten einen ungetrübten Blick auf den Nachthimmel. Im Hochgebirge, an der Küste und abseits der modernen Zivilisation gibt es das eher noch so wie in der Welt, in der Jesus lebte: Der Himmel ist klarer zu sehen. Und man hat, wenn man ohne Strom und Internet die Nacht nicht zum Tag macht, auch mehr Zeit, sich damit zu befassen. In Bethlehem, auf fast 800m Höhe und meist in trockener, klarer Wüstenluft muss der Anblick des Himmels für unsere Verhältnisse spektakulär gewesen sein.
Für die Menschen im Altertum war ganz selbstverständlich: Zwischen Himmel und Erde existiert ein Zusammenhang. Was oben passiert, hat mit dem zu tun, was unten passiert. Alles steht in Verbindung, alles kommuniziert. Das müssen wir heute erst wieder entdecken, dass die Atmosphäre (der „erste Himmel“) und die Erdoberfläche nicht Rohstoff oder Kulisse ist, sondern dass es Wechselwirkungen hin und her gibt (Simon de Vries schrieb diese Woche über Bruno Latour und sein Terrestrisches Manifest, in dem das eine große Rolle spielt).
Die Weisen (Mt 2,1-12) waren Sterndeuter, keine Esoteriker, sondern Intellektuelle der damaligen Zeit, die nicht unterschied zwischen Astronomie und Astrologie. Wir unterschieden das heute zu Recht. Außer Mond und Sonne haben die Himmelskörper keinen erkennbaren Einfluss auf das private und öffentliche Leben. Horoskope sind Humbug. Den Himmel sehen wir trotzdem gern an – ich komme später darauf zurück.
Sterne spielten anders als heute auch in der Politik eine Rolle. Im Jahr 44 v. Chr., kurz nach der Ermordung Cäsars, stand Berichten zufolge ein Komet am Taghimmel über Rom. Das Volk glaubte damals, Cäsar sei aufgenommen worden unter die Götter. Augustus sah es als günstiges Zeichen über die Spiele, die er zu der Zeit als Nachfolger und Erbe Cäsars abhalten ließ. Der Historiker Plinius kommentiert: „ …in seinem Innern aber war er mit Freude davon überzeugt, dass der Stern für ihn aufgegangen sei, und dass er mit ihm aufgehe – und zwar, wenn wir die Wahrheit sagen wollen, zum Heile der Welt.“ Ein Stern, ein Heilsbringer, eine neue Zeit.

Der König kriegt die Krise
Aber nun, vierzig Jahre später, strahlt ein neuer Stern am Himmel. Weise machen sich auf den Weg – aus Persien oder dem Zweistromland – und kommen nach Jerusalem. Und wir erleben ein Drama mit vertauschten Rollen: Die Heiden haben lange vor Herodes und seinen Leuten kapiert, dass der Messias geboren wird.
Das jedoch wäre das letzte, was Herodes brauchen kann. Der hat weder einen Stern gesehen, noch Besuch von einem Engel bekommen, und wohl auch von ganz anderen Dingen geträumt: Prunkbauten, die seinen Namen tragen eventuell…
Herodes erwartet von dem kommenden Messias alles das, was er selber tun würde und worin er geübt war: einen blutigen Machtkampf. Im Übrigen hat er keine Ahnung vom voraussichtlichen Geburtsort des Messias. Er hält sich selbst für den Messias – oder möchte zumindest so gesehen werden. Dafür hat er den Tempel in Jerusalem prunkvoll erneuert, schöner und größer als je zuvor. Und nun herrscht er von Gottes – und mindestens so sehr von Augustus’ – Gnaden in Jerusalem. Mit harter Hand.
Daher der Schrecken. Wir wissen, was folgt: Blutvergießen im großen Stil.
Geschichte wiederholt sich
Herodes ist in dieser Erzählung des Matthäus der Schurke. Die größte Gefahr droht dem Messias also aus den eigenen Reihen. So weit ist es mit Israel gekommen.
Aber vielleicht ist das ja öfter der Fall: Den schlimmsten Schaden haben unserem Land die Nationalsozialisten zugefügt. Nicht die Russen, Franzosen oder Amerikaner.
Den schlimmsten Schaden haben den Kirchen nicht die Christenverfolgungen zugefügt, sondern machtgierige, prunksüchtige Kirchenfürsten, kontrollwütige Kleriker, verlogene und selbstgerechte Fromme.
Hier steht nun der wahre König der Juden gegen den falschen. Und der wahre Heilsbringer für den Erdkreis gegen den falschen. All die Geschichten, die jetzt noch folgen, werden das entfalten.
Dieser Messias „gehört“ nicht seinem Volk und auch keinem anderen. Er ist größer als der Gegensatz zwischen Juden und Heiden und die Konflikte, die daraus folgen. Er gehört auch nicht den christlichen Kirchen. Er ist niemandes Besitz. Wenn, dann verhält es sich genau umgekehrt. Wieviel darf er von mir haben, von uns, von dieser Welt?
Nochmal von vorn
Herodes tritt hier in die Fußstapfen des Pharao aus dem Buch Exodus. Auch der ließ um des Machterhalts willen kleine Jungs umbringen. Und Jesus ist der neue Moses, der dem Gemetzel entgeht, der in der Wüste verschwindet und als Prophet zurückkommt, um sein Volk in die Freiheit zu führen.
In Jesus nimmt Gott die Geschichte Israels auf, er rekapituliert sie und führt sie seinem großen Ziel entgegen. Die Weisen sind ein Hinweis darauf, dass wir uns dieses Ziel nicht zu klein vorstellen dürfen.
Wahre Weisheit
Herodes ist also nicht das Vorbild in dieser Geschichte, die Weisen sind es. Sie machen eine ganze Menge richtig. Das zum Beispiel:
- Sie suchen Gott (bzw. den Messias / die Wahrheit) um seiner selbst willen, ohne ihn für sich vereinnahmen zu wollen.
- Sie hören auf ihre jüdischen Kollegen, die Schriftgelehrten und führen (so würden wir das heute sagen) ein respektvolles, fruchtbares interreligiöses Gespräch.
- Sie bringen Geschenke, ohne sie mit Erwartungen zu verbinden. Ein Neugeborenes hat ohnehin nichts, was es zurückgeben könnte.
- Sie denken nicht nur analytisch, sondern sie stehen auch in gutem Kontakt mit ihrem Inneren. So können sie aus Träumen die richtigen Schlüsse ziehen. Sie lassen Jerusalem und Herodes links liegen und gefährden das Kind nicht.
Wir haben heute keinen Stern am physischen Himmel, der uns hilft bei der Suche nach Gott. Aber wir haben unsere Sehnsucht als Kompass. Es könnte sich lohnen, ihr zu folgen. Sehnsucht nach dem Wahren, Schönen und Guten (für die Intellektuellen und Ästheten), nach Frieden und Gerechtigkeit (für die Aktivisten), nach der Heilung der Welt (für die Leidenden und Mitfühlenden) kann uns auf die richtige Spur bringen.
Und weil auch uns Aufgeklärte mit all der Naturwissenschaft im Hinterkopf der Blick zu den Sternen, wenn sie mal wieder gut zu sehen sind, an diese Sehnsucht erinnert, sollten wir uns den Nachthimmel, so oft es geht, gönnen. Und uns von Gott ergreifen lassen.


















 …
…