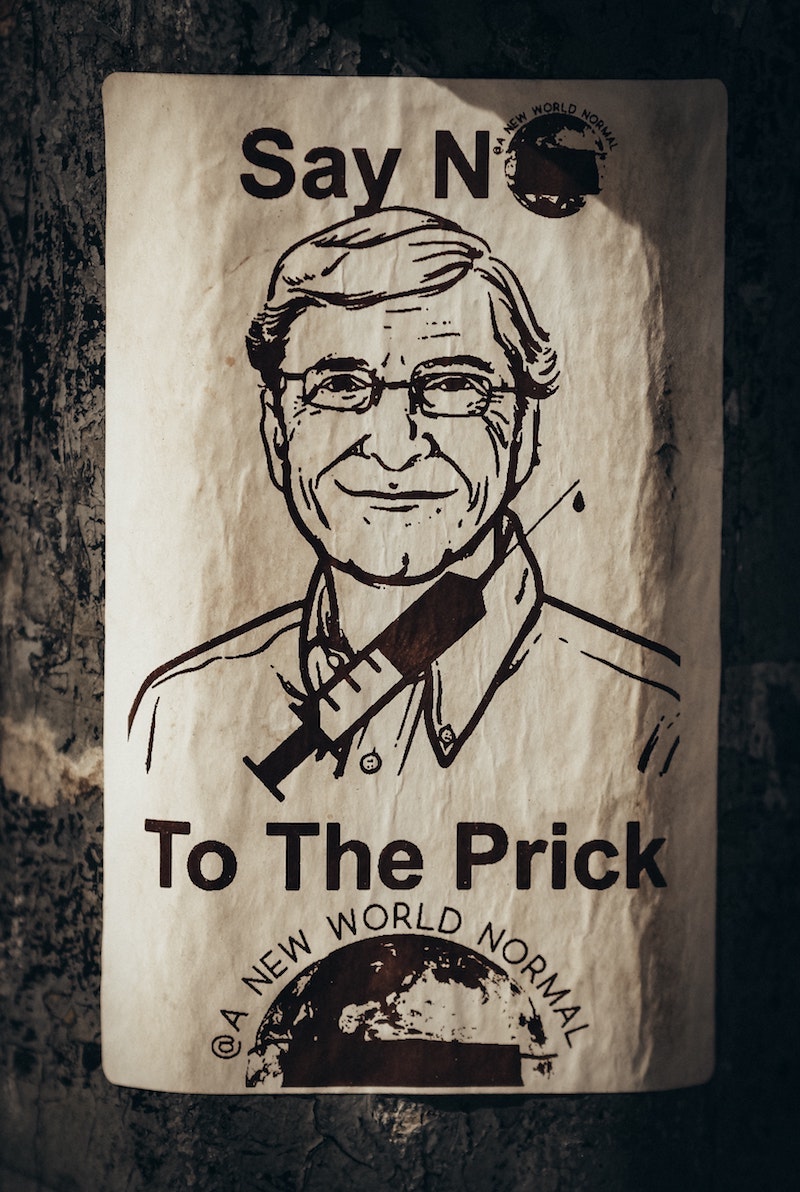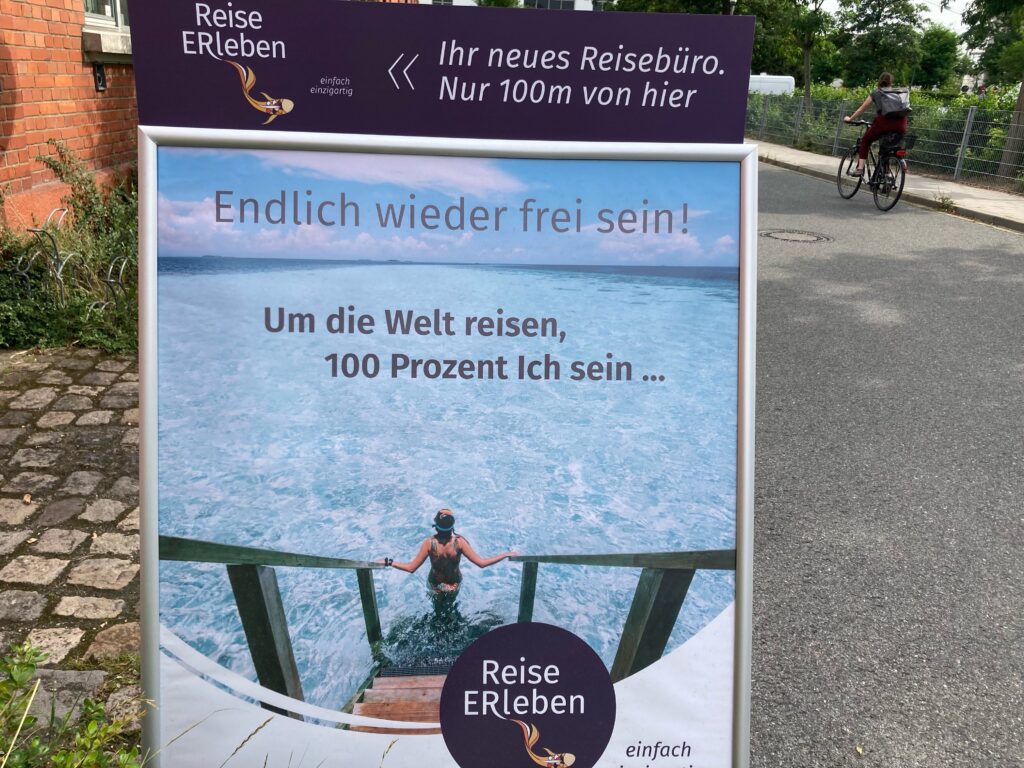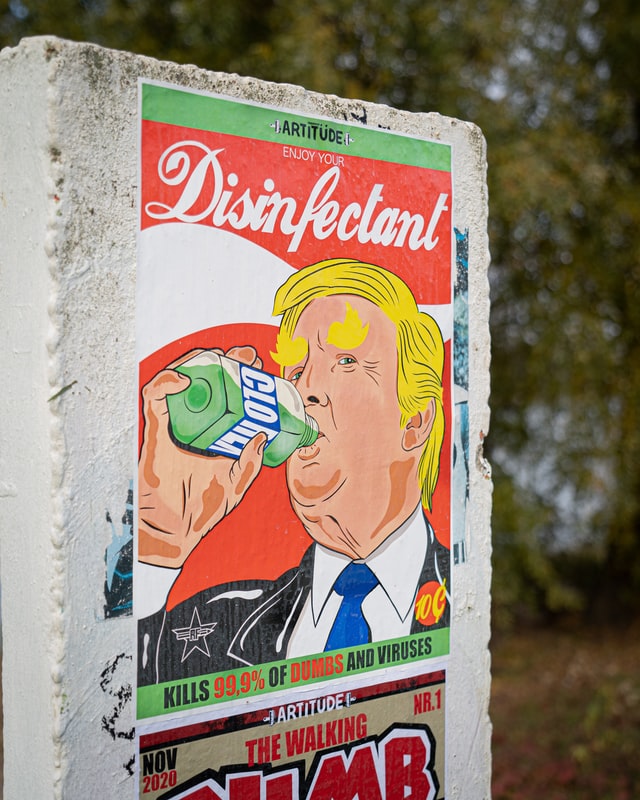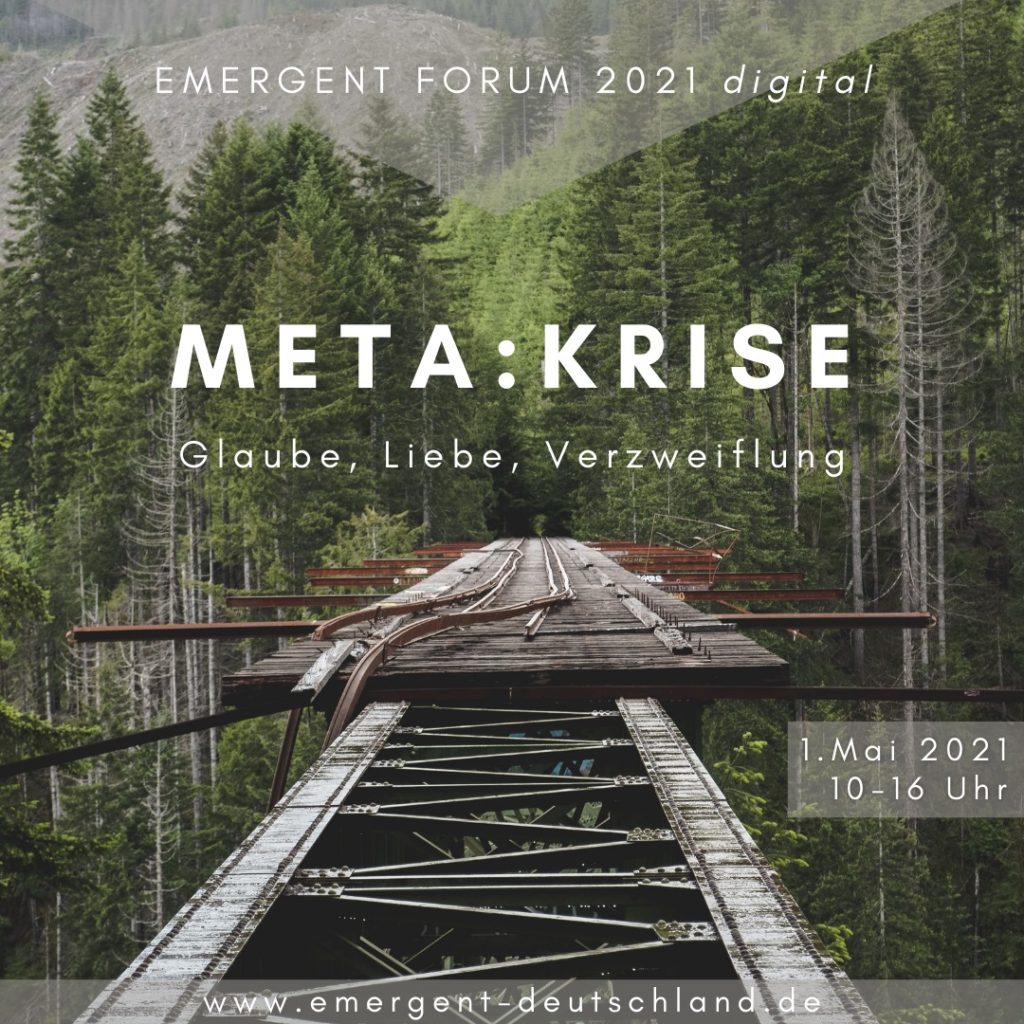(Evangelische Morgenfeier im BR am 3. Advent 2021)
Mein Internet geht nicht. Es ist schon das x-te Mal innerhalb weniger Wochen. Ich rufe also wieder einmal bei der Hotline meines Anbieters an, um das Problem zu melden. Zum Schluss des Telefonats bittet mich die Person am anderen Ende der Leitung, noch nicht aufzulegen. Erst soll ich noch eine Bewertung abgeben. Das sei ganz wichtig für sie.
Ich bleibe grollend in der Leitung. Nicht genug damit, dass mich die Verbindungsabbrüche Zeit und Nerven kosten, ich muss jedesmal auch noch Zeit dranhängen, um die Mitarbeiter zu bewerten. Denn wenn ich das nicht tue, kreidet der Arbeitgeber es seinen Kundenberatern anscheinend an.
Ich kenne den Dialog mit dem Computer inzwischen auswendig. Während die Automatenstimme noch die Frage formuliert, sage ich schon ebenso mechanisch „Zehn“ – „Zehn“ – „Zehn“. Und als ich dann noch gefragt werde, was ich noch sagen will, gebe ich zornig zu Protokoll, wie nervtötend ich diese ständige Bewerterei finde. Wie entwürdigend der unterschwellige Zwang dazu auf mich wirkt. Null von zehn Punkten für diesen Umgang mit Kundinnen und Personal. Bitte gleich wieder abschaffen!
Jeder popelige Online-Shop will von mir inzwischen eine Bewertung der Ware und des Einkaufserlebnisses, auch wenn es nur Büroklammern sind. Und jetzt, mit all den Weihnachtseinkäufen, komme ich gar nicht mehr hinterher. Überall soll ich Punkte, Sterne und so weiter vergeben. Für meinen Hotelaufenthalt auf einem Kärtchen im Zimmer. Für denselben Hotelaufenthalt einen Tag später im Buchungsportal, wo ich ihn ausgewählt hatte – aufgrund der vielen guten Bewertungen natürlich…
Ich lege auf und denke: Das muss doch wahnsinnig anstrengend sein, permanent beobachtet und beurteilt zu werden. Mir fallen Situationen ein, in denen ich das Gefühl hatte, dass andere auf Fehler von mir lauern. Oder Maßstäbe anlegen, die mir fremd oder zuwider sind. Forderungen aufstellen statt Wünsche formulieren. Und wie schwer es war, zu verhindern, dass diese äußeren Stimmen zu Stimmen in meinem Kopf werden: Ein ständiges Selbstgespräch mit dem inneren Kritiker, der sich die Argumente und Positionen der äußeren Kritiker zu eigen macht. Übrigens: Auch diese Morgenfeier im BR können Sie online bewerten!
Journalisten sprechen von der „Schere im Kopf“, die eine Zensur von außen oder von oben überflüssig macht. Wenn der Chefredakteur oder ein potenter Anzeigenkunde immer wieder mal durchblicken lässt, was er künftig nicht mehr lesen möchte, dann redigieren sich die Texte quasi von alleine. Und wenn das Bewerten im digitalen Zeitalter dann auch noch in Echtzeit stattfindet, werden Mitarbeiter dann nicht früher oder später konditioniert wie Pawlows Hund? Anders gesagt: Sind die erfolgreichsten Influencer und Selbstvermarkter am Ende die, die gar nichts Originelles an sich haben, sondern einfach nur Kunstfiguren, die die vorhandenen Erwartungsschablonen perfekt bedienen?
Wenn ich darüber nachdenke, spüre ich diese Dankbarkeit in mir für alle Situationen, in denen ich mich unbefangen bewegen kann. In denen eine Atmosphäre des Wohlwollens und der Wertschätzung herrscht, in denen ich Fehler machen darf, weil ich als Person gesehen werde und nicht nur meine Leistung zählt.
Aber das gibt es halt nicht immer…
Kein Fünf-Sterne-Apostel
Paulus, der umtriebige Apostel aus der Bibel, ist so jemand, der sich seine Unbefangenheit auch unter schwierigen Umständen bewahrt hat. Im Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt er:
Dafür soll man uns halten: für Diener von Christus
1. Korinther 4,1-5 (Basisbibel)
und Verwalter von Gottes Geheimnissen.
Nun verlangt man ja von Verwaltern, dass sie zuverlässig sind.
Aber mir ist es völlig gleichgültig,
ob ihr oder ein menschliches Gericht mich beurteilt.
Ja, ich beurteile mich nicht einmal selbst.
Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst.
Aber deswegen gelte ich noch nicht als gerecht.
Nur der Herr kann über mich urteilen.
Urteilt also nicht schon jetzt.
Wartet, bis der Herr kommt!
Er wird alles ans Licht bringen, was im Dunkeln verborgen liegt,
und die geheimsten Absichten enthüllen.
Dann wird jeder von Gott gelobt werden, wie er es verdient.
Paulus ist in Korinth in einem schwierigen Umfeld unterwegs. In der geschäftigen Hafenstadt herrscht ein reges Kommen und Gehen, und wer nicht ausreichend trommelt, wird übersehen und gerät in Vergessenheit. Da muss man sich gut präsentieren und verkaufen. Und in der Gemeinde werden Zweifel laut, ob Paulus das ideale Aushängeschild ist. Rein äußerlich macht er nicht viel her. Im Vergleich zu den muskulösen Statuen der Superhelden von damals schneidet er ähnlich schlecht ab, wie er das heute unter all den aufgebrezelten Influencer*innen im Netz täte. Er schafft es auch nicht, den Nachteil durch eine sonore Stimme und gewinnende Redekunst auszugleichen. Noch ärgerlicher: Aussehen und gewandtes (wir würden sagen: professionelles) Auftreten scheinen ihm egal zu sein. Offenbar kennt er die „Karrierebibel“ nicht, die mir verrät: Bei den meisten Menschen geht innerhalb von wenigen Sekunden der Rolladen herunter. Sie verlieren das Interesse, wenn mein Aussehen nicht passt, mein Duft (japp, steht da…) oder der Klang meiner Stimme.
Paulus ist also kein Fünf-Sterne-Apostel, sondern eher Mittelmaß in den Augen und nach den Maßstäben seiner Umgebung. Aber er nimmt sich das nicht besonders zu Herzen. Er lässt es einfach stehen. Ohne zu diskutieren. Ohne sich zu beschweren über unfaire oder verletzende Kritik. Ohne sich zu rechtfertigen oder zu verteidigen. Und auch darin unterscheidet er sich von den Reflexen, die ich von mir und anderen kenne. „Ich beurteile mich nicht einmal selbst“, sagt er. Wenn ich mich gegen Kritik wehre, anderen das Recht oder Kompetenz abspreche, über mich zu urteilen, dann wäre das immer noch ein Urteilen über mich selbst: „Ihr sagt, ich mache meinen Job nicht richtig. Aber das zeigt nur, dass ihr keine Ahnung habt – oder unkollegial und arrogant seid.“ Wie leicht wäre es für Paulus gewesen, einen auf unverstandenes Genie zu machen und um sich herum einen Fanclub zu scharen, der ihn anhimmelt. Aber selbst das ist ihm egal.
Ich staune über diese Größe und Unabhängigkeit. Ein bisschen erinnert es mich an eine andere Geschichte aus dem alten Korinth. Alexander der Große stattet dem Philosophen Diogenes in seiner legendären Tonne einen Besuch ab. Auf die gönnerhafte Frage, was Diogenes sich an diesem Glückstag von ihm wünsche, antwortet der lapidar: „Ach, geh doch bitte aus der Sonne“.
Noch ein bisschen trotzig-rotziger bringen es die Ärzte auf den Punkt: „Was sagen denn die Leute?“ ist nicht immer die beste Frage für ein glückliches Leben:
Die Marke Ich
Das Lebensideal der Antike, für das Alexander steht (und auf das Diogenes pfeift) war der unsterbliche Ruhm. Heute, in der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie, taucht das wieder auf. Wir werden vielleicht nicht alle finanziell reich, aber wir können alle bekannt werden. Theoretisch jedenfalls. Praktisch entwickeln viele junge Menschen durch Instagram, wo sie sich sich täglich dem Vergleich mit den Schönsten und Stärksten aussetzen, vielfach ein negatives Selbstbild. Eine Expertin stellt fest: „Die jungen Frauen spüren sich nicht mehr, sie horchen nicht in sich hinein, es geht nur ums Äußerliche und sie werden unglaublich sensibel für Ablehnung.“
Aber auch Jungs und Männer wollen gut ankommen: Sebastian Kurz hat dieses Spiel mit Medien und Aufmerksamkeit so gut beherrscht wie nur wenige Politiker. Was wurde nicht gefeiert als Senkrechtstarter, Wunderkind, Lichtgestalt. Das Drehbuch für seinen kometenhaften Aufstieg verrät uns der Business-Beststeller „Die Marke Ich“. Dessen Grundgedanke lautet, dass positives Denken allein noch nicht ausreicht. Es muss auch offensiv zur Schau gestellt werden.
Damit andere mich positiv bewerten, muss ich mich selbst so unwiderstehlich finden, dass es mir zu jedem Knopfloch herauskommt. Und darauf setzen, dass der Funke überspringt. Andere sind nur dann überzeugt von mir, wenn ich mich selbst feiere. Am besten, ich erscheine überall mit einer Entourage, die mir auf Schritt und Tritt Bussis zuwirft.
Diese Strategie der Selbstglorifizierung hat lange funktioniert. Menschen lassen sich anscheinend gern bezaubern. Freilich musste dazu auch eine Menge Dreck unter den Teppich gekehrt werden, wie wir heute wissen. Irgendwann war die Kluft zwischen Wunschbild und Wahrheit nicht mehr zu überbrücken. Nun ist die „Marke Ich“ ruiniert und Kurz zieht sich lieber aus allen Ämtern zurück als ohne Strahlemann-Nimbus weiterzumachen – und Politik als Handwerk zu betreiben statt als Show.
Ich fange an zu verstehen, warum Paulus sich nichts aus Beifall und Bewunderung macht. Die einzige Bewertung, die für ihn zählt, kommt von seinem göttlichen Auftraggeber. Und sie steht noch aus – „bis der Herr kommt“. Da liegt auch der Bezug zum Advent: Christen betrachten das Leben und die Welt im Horizont des Kommens Gottes. Der Morgenstern ist schon aufgegangen. Bald ist die Dunkelheit vorbei. Und erst dann sehen wir klar.
Geschenkte Selbstvergessenheit
Ben Zander ist Dirigent des Boston Philharmonic Orchestra und unterrichtet am Konservatorium. Schon bald fällt ihm auf, dass viele seiner Studierenden unter Prüfungsangst leiden und deshalb total blockiert in den Kursen sitzen. Das muss doch anders gehen, denkt er sich, und verkündet zu Beginn des nächsten Semesters: „Ich werde euch allen eine Eins geben. Einzige Bedingung: Ihr schreibt mir einen Brief, in dem Ihr erzählt, was für ein Mensch Ihr am Ende dieses Kurses sein wollt.“ Von da an unterrichtet er keinen ängstlichen Haufen mehr, sondern eben die Menschen, denen er beim Lesen der Briefe begegnet ist. Die Spaß am Lernen haben, weil sie sich nicht auf Schritt und Tritt beobachten und sich nicht ständig fragen, ob das, was sie können, denn reicht.
Die Eins, die Zander vergibt, ist eigentlich ja keine Bewertung im technischen Sinn, sondern die Einladung, auf Bewertungen zu verzichten und sich stattdessen auf das Wesentliche zu konzentrieren. Oder anders gesagt: Einfach mal zu machen, einfach mal einzutauchen in die Musik und den Umgang mit dem Instrument, also bei der Sache selbst zu sein und nicht beim Messen, Vergleichen und Bewerten. Sie, liebe HUH, kennen das vielleicht auch: Musiker*innen, die ihre Augen schließen, weil sie so versunken sind in ihr Spiel, und erst beim Applaus des Publikums aus ihrer Trance aufzuwachen scheinen.
Glaube, sagte einer meiner Professoren im Studium – und ich habe es nie wieder vergessen –, Glaube ist gewährte Selbstvergessenheit. Ich vergesse, über mich nachzudenken und mich mit anderen zu vergleichen. Es ist ein bisschen wie Verliebtsein: Wenn ich dieser einen Person nahe bin und gefalle, spielt es für mich kleine große Rolle mehr, was andere über mich denken oder sagen. Und manchmal ist es auch wie Trauern: Weil mir diese eine geliebte Person so fehlt, können auch die freundlichsten Worte und Gesten aller anderen die Lücke nicht füllen. So oder so – alles, woran ich denken kann, ist die oder der Geliebte. Und wenn wir zusammen sind, ist es fast egal, was wir machen (und ob wir damit Erfolg haben), so lange wir nur zusammen sind. Liebende finden sogar die Schwächen des anderen noch liebenswert.
In der Liebe hört das Bewerten und Beurteilen auf. Oder andersherum: Das Bewerten schadet der Liebe. Denn wenn ich eine andere Person beurteile, verlasse ich damit die Augenhöhe. Mit einem guten Freund ging es mir eine Weile lang so, dass ich mich immer wieder beurteilt fühlte. Es war zwar deutlich mehr Lob als Kritik, aber auch ein positives Urteil ist ein Urteil. Das Analysieren und Bewerten war ihm so in Fleisch und Blut übergegangen, dass er es schwer ausknipsen konnte, nicht einmal sich selbst gegenüber. Da konnte er noch härter und fordernder sein als anderen gegenüber.
Die Alternative zu Lob und Tadel ist ganz einfach: Statt zu bewerten kann ich einfach beschreiben, was ich an anderen sehe und was ich für sie empfinde. Und schon bin ich draußen aus solchen Gegensätzen wie richtig/falsch, gut/schlecht, schön/hässlich, Gewinn/Verlust. Auf die liebenswerten Eigenarten, die einen Menschen unverwechselbar machen, lassen die sich sowieso nicht anwenden. Die kommen erst dann in den Blick, wenn ich das wertende Urteil aussetze. Wenn ich nicht mehr im Denken bin, sondern im Schauen. Und im wortlosen, selbstvergessenen Staunen.
Die vielen Widersinne
In Rainer Maria Rilkes Stundenbuch habe ich die folgenden Zeilen gefunden:
Wer seines Lebens viele Widersinne
versöhnt und dankbar in ein Bildnis fasst
der drängt die Lärmenden aus dem Palast
wird anders festlich und du bist der Gast
den er an sanften Abenden empfängt
Vieles passt in meinem Leben nicht zusammen. Nicht im Inneren, nicht im Äußeren. Überall bleiben Widersprüche stehen. Sie lassen sich auch nicht gegeneinander aufrechnen, so dass unter dem Strich eine klare Bilanz zu erkennen wäre. Oder dass gute Taten ein Versagen an anderer Stelle tilgen.
Es bleibt nur das Schauen, die „Kontemplation“. Das alles bin ich, das alles geht in mir vor, das alles gehört zu meinem Leben. So ist es, und so darf es vor Gott auch sein. Es ist eine Momentaufnahme. Ein Wimmelbild vielleicht, ein Bild mit starken Kontrasten und Farben, die sich manchmal beißen. Aber es ist die gegenwärtige Wirklichkeit.
Irgendwann trollen sich dann die Lärmenden, die Ansprüche und wertenden Urteile meiner Umgebung, die Stimmen in meinem Kopf. Und eine andere Stimme, eine andere Gegenwart stellt sich ein. Diesem Gast muss ich nichts erklären, nichts kaschieren oder beschönigen. Er kennt alle meine Geheimnisse. Und er hält es mit mir auch dann aus, wenn ich selbst lieber davonlaufen würde.
Das Urteil aussetzen. Nicht taxieren, nicht werten, messen, vergleichen oder aufrechnen. Schauen mit dem Herzen. Atmen und spüren, was da ist. Präsent sein, leiblich, an diesem Ort und in diesem Moment. Und nicht im Kopf schon wieder woanders. Braucht es nicht genau diesen Blick, um in dem Jesuskind, für das kein Platz war, den kommenden Messias zu erkennen? Und im verurteilten und gekreuzigten Christus die Liebe Gottes, die sich für uns zerreißt? Gottes „Widersinne“ – sie sind das Geheimnis, das Gott Paulus anvertraut hat und dessen Hüter er ist.
In der Erfahrung, dass Gott diesen liebevollen, festlichen Blick auf mich hat, finde auch ich die Freiheit, meinen Weg zu gehen. Unbefangen, selbstvergessen, manchmal fast spielerisch – und zugleich ernsthaft und mutig.