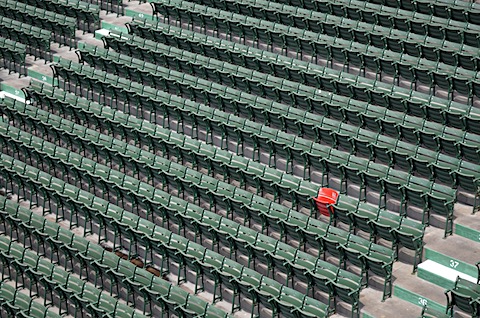Multiple, sich überlagernde und gegenseitig verschärfende Krisen sind das Kennzeichen des 21. Jahrhunderts. Die großen Kirchen sind in ihrer institutionellen Form Geschöpfe des 20. Jahrhunderts und kommen erst allmählich in dieser Realität an. An vielen Stellen sind wir zudem noch mit unseren eigenen, internen Krisen beschäftigt. Nicht alle sind begeistert von der Idee, sich in die hitzigen Debatten einzumischen und Position zu beziehen.
Und selbst wenn, es bleibt noch die Frage, was unser Beitrag sein könnte oder sollte. Auch da liegen die Einschätzungen zum Teil weit auseinander. Hier werfe ich einen Blick auf die beiden Pole. Es gibt freilich viel dazwischen, aber diese Mitte ist, wie ich zeigen möchte, auch alles andere als golden.
Die Ausgangslage
Auch wenn der Ukrainekrieg gerade fast alles überlagert, die Nachrichten von der Klimafront müssten uns noch viel mehr Sorgen machen. Hier ein paar Schlaglichter der letzten Wochen:
Team Regenbogen
Im Team Regenbogen denkt man: Schlechte Nachrichten gibt es in der Welt mehr als genug, Christen müssen Hoffnung verbreiten. Also konzentrieren wir uns auf das Gute, das geschieht, und weniger auf das Bedrohliche und Deprimierende. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Wir betonen die Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, die ganz am Ende der Bibel steht, oder wir gehen ganz an den Anfang der Bibel und betonen die Treue Gottes zu seiner Schöpfung in der biblischen Urgeschichte. Als fest etabliertes Gegenbild zum Klimakollaps dient dann meist der Regenbogen. Gott hat ja versprochen, dass nicht alles den Bach runtergeht. Wer hingegen alarmistisch agiert, verrät damit nur den eigenen Unglauben. Und wenn er/sie auch noch emotional wird, stört die „Hysterie“ den Seelenfrieden, den zu verbreiten unser Auftrag ist.
Fragen an das Team Regenbogen
Aber ist es wirklich so, dass „die Welt“ (also unser öffentlicher Diskurs) sich den Tatsachen der Klimakrise und den begründeten Prognosen der Klimaforschung stellt? Mir scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein: Verharmlosung, Verdrängung, Verschleppung sind an der Tagesordnung. „Keep it light, fun“ ist die irre Anweisung, die das Team der TV-Nachrichten in der Satire „Don’t Look Up“ den Wissenschaftler:innen erteilt, die den Asteroiden auf Kollisionskurs entdeckt haben und vor einer globalen Katastrophe warnen. Aber die Satire liegt eben ganz nah an der Wirklichkeit.
Ob der Regenbogen, der einem Wolkenbruch häufig vorausgeht oder folgt, für die Flutopfer im Ahrtal (oder sonst irgendwo auf der Welt) noch irgendwelche tröstlichen Gefühle bereithält, wäre erst noch zu verifizieren. Und mit dem Verweis auf die Neuschöpfung lässt sich das milliardenfache Leid, das die Erdüberhitzung in den kommenden Jahrzehnten mit sich bringen wird, ähnlich elegant überspringen wie mit dem Hinweis, dass „die Natur“ den menschengemachten Kollaps freilich überleben wird – nur halt die Spezies Homo Sapiens (und ein paar hunderttausend andere) nicht. Zudem macht die Ewigkeitsperspektive (egal ob theistisch oder atheistisch) den immensen Zeitdruck unsichtbar, unter dem wir fünf Jahre vor einem wahrscheinlichen Point of no return stehen.
Billige Hoffnung?
Könnte es analog zu Bonhoeffers „billiger Gnade“ auch eine billige Hoffnung geben? Sie wäre billig, wenn sie sich an der aufreibenden Konfrontation mit den gewaltigen Kräften des „Weiter so“ vorbeimogelt. Sie wäre billig, wenn sie vertröstet und dabei verharmlost, was Menschen jetzt schon und künftig das Leben zur Hölle macht.
"Sie heilen den Schaden meines Volks nur obenhin, indem sie sagen: »Friede! Friede!«, und ist doch nicht Friede."
Diese Klage des Jeremia gegen das Abwiegeln der Priester und Tempelpropheten ging mir in den letzten Wochen immer wieder durch den Kopf, als ich so manches „wir-haben-Putin-unterschätzt“-Bekenntnis las. Die Folgen dieser Fehleinschätzung sind noch nicht absehbar. Aber das wirft die nächste Frage auf: Wiederholen wir diesen Fehler, wenn wir uns in der Klimafrage vor Positionen scheuen, die in der veränderungsresistenten Mitte der Gesellschaft als „radikal“ erscheinen könnten?
Bei allem, was man in den biblischen Schöpfungstexten an wunderbaren Perspektiven auf die Erde und unsere Mitgeschöpfe lernen kann, stammen sie doch weitgehend aus den königlich-priesterlichen Traditionen des Alten Testaments. Disruption ist dort nicht vorgesehen, da geht es um Stabilität und Kontinuität – wie in der bürgerlichen Politik. Aber Disruption auf allen Ebenen (Klima, sozialer Friede, Demokratie) ist genau das Thema, mit dem wir jetzt wie nie zuvor konfrontiert werden. Die biblischen Schöpfungstexte spiegeln die Lebensbedingungen des Holozän wieder. Dass diese sich im Anthropozän radikal ändern könnten, war für ihre Verfasser unvorstellbar. Sie geben keine Garantie, dass Gott uns schon davon abhalten wird, die Kippunkte zu überschreiten.
Team Apokalypse
Die biblische Apokalyptik ist ein Kind der Prophetie. Die Propheten waren und sind die Systemkritiker, die Gottes Vorbehalt gegenüber den Mächtigen und ihrem Gebaren verkörpern, oft genug auch seinen ausdrücklichen Protest. Die Propheten spitzen zu – polemisch in ihren Gerichtsdrohungen und poetisch in ihren Verheißungen des Heils, während um sie herum gerade alles zusammengebrochen ist.
In der Apokalyptik entwickelt sich diese herbe Krisenpoesie weiter. Reale weltpolitische Umbrüche erscheinen als Kampf mythischer Wesen, Irdisch-Geschichtliches wird auf eine kosmische Leinwand projiziert. Die Elemente (Himmel, Meer, Erde, Winde) erscheinen als Akteure (Bruno Latour lässt grüßen) in diesem Geschehen. Mit ihrer Hilfe führt Gott den Sturz der Gewaltherrscher herbei.
Die Apokalyptik gibt uns Worte und Bilder für die Gegenwart, in der die Menschheit sich je befunden hat. Wir sind dabei, kollektiven Selbstmord zu begehen, sagte UN-Generalsekretär Guterres schon im Dezember 2020. Der neigt normal nicht zur Panik, aber es ist gerade nichts normal. John Kerry, der Klimabeauftragte der US-Regierung, spricht von einem „globalen Selbstmordpakt“. Es ist grotesk, und das lässt sich mit normaler Sprache nicht mehr adäquat wiedergeben. Die Rohstoffkonzerne sind Ungeheuer, die das Leben auf der Erde dem Profit opfern.
»Klimaaktivisten werden manchmal als gefährliche Radikale dargestellt, aber die eigentlichen gefährlichen Radikalen sind die Länder, die die Produktion fossiler Brennstoffe steigern.« (Antonio Guterres)
Apokalyptik ist nicht Panik, sondern der neue Realismus. Es ist bitterernst. Es ist Zeit für Klage, Zorn und Galgenhumor. Alles, was nicht abwiegelt und „normalisiert“. Alles, was nicht den Eindruck erweckt, wir hätten unbegrenzt Zeit, uns in winzig kleinen Schritten fortzubewegen, das Ruder erst einmal sachte acht oder achtzehn Grad zu drehen anstatt der nötigen 180.
In den großen Kirchen haben wir uns die Apokalyptik abgewöhnt, weil über die Jahrhunderte immer wieder falscher Alarm ausgelöst wurde. Ich erspare mir jetzt die Aufzählung aller Personen und Bewegungen, die den Weltuntergang irrtümlich für ihre Lebenszeit vorhergesagt hatten. Die schrägen Endzeitszenarien der „Left Behind“-Romane sind nur das jüngste Beispiel für sektiererische Verdrehungen. Aber das bedeutet ja nicht, dass es auch einen berechtigen Alarm geben kann und eine sachgemäße Interpretation der biblischen Apokalyptik. Sicher nicht als Endzeit-Fahrplan, der sich eins zu eins dem Gang gegenwärtiger Ereignisse zuordnen lässt (so war es nie gemeint). Wohl aber als Aufforderung, das Undenkbare zu denken – das Ende der Mächte und Akteure, die „die Erde verderben“ (Offb 11,18).
Der wandernde Horizont
Apokalyptik bedeutet nämlich nicht immer gleich Weltuntergang. Nicht der Kosmos wird vernichtet, sondern die Weltzeit (Aion) geht zu Ende. In der Bibel sehen wir einen wandernden eschatologischen Horizont. Für die großen Schriftpropheten ist es die Zerstörung Jerusalems und des ersten Tempels. Im Danielbuch ist es der Untergang der antiken Weltreiche. Jesus kündigt die Zerstörung Jerusalems durch die Römer an und bei Paulus und dem Seher Johannes richtet sich der Blick auf das Ende des Imperium Romanum. Nicht die Welt geht unter, aber die Welt, wie wir sie kennen. Und nun steht uns mit dem sich anbahnenden Kollaps des Klimas und dem Ende des Holozäns ein Zivilisationsbruch ins Haus, der all jene Untergänge in den Schatten stellt. Andrew Perriman hat dazu viel Lesenswertes geschrieben, und auch er betont dabei die prophetische Dimension:
First, the church needs to recover a plausible prophetic voice—to warn, to call for repentance and change, to explain how and why the crisis has come about, to begin to outline a new meaningful, sustainable, long-term future for the church in the secular-humanist West, to keep the story moving forwards.
Tom Wright weist in seinen Arbeiten zur Verkündigung Jesu immer wieder darauf hin, dass Albert Schweizer die richtige Fährte verfolgte, als er gegen die Leben-Jesu-Forschung die apokalyptische Dimension radikal herausstellte. Und er merkt zugleich an, dass Schweizer irrtümlich annahm, Jesus habe von einer kosmischen Katastrophe gesprochen und nicht von der Zerstörung Jerusalems im jüdischen Krieg. Für Wright spricht Jesus nicht vom Ende der Geschichte, sondern vom Ende einer Ära.
Jesus war Apokalyptiker und Prophet. Die Selbstbezeichnung „Menschensohn“ ist ein unübersehbarer Hinweis darauf. Zu den königlich-priesterlichen Traditionen verhielt er sich (vorsichtig gesagt) sehr differenziert. Bilder und Begriffe, mit denen Jeremia und andere den Untergang Babylons angekündigt hatten, überträgt er in Markus 13 auf die Hauptstadt Judäas. Er weint und klagt, er provoziert und dramatisiert wie seine Vorläufer. Er stößt auf taube Ohren bei der Mehrheit seiner Landsleute. Und er wird, wie Jeremia, von den Mächtigen dafür aus dem Weg geräumt.
„Hoffnung“ kommt in den Evangelien nicht vor
Es ist schon bemerkenswert, dass in keinem der vier Evangelien der Begriff „Hoffnung“ auftaucht. Ich will damit nicht sagen, dass die Sache fehlt. Aber angesichts der inflationären kirchlichen Hoffnungsrhetorik könnte das durchaus ein Wink sein, diesen Anspruch an uns selbst einmal kritisch zu betrachten, immer und überall Hoffnung liefern zu können oder zu müssen. Vielleicht muss auch die alte Hoffnung sterben (oder wir müssen angesichts des Infernos „alle Hoffnung fahren lassen“), damit sie irgendwann neu geboren werden kann.
Vielleicht sollten wir das Wort Hoffnung mal ein, zwei, zehn Jahre nicht verwenden. Und wie Jesus anders von Gott und der Welt reden. Hoffnungsfähig werden wir wohl nur, wenn wir den Kollaps nicht verharmlosen, das Grauen nicht verdrängen, die Klage nicht dämpfen, die Schuld nicht beschönigen. Hoffnung findet vielleicht wieder einen Landeplatz, wenn wir Gott recht geben in seinem Urteil über unsere Zivilisation, deren Wohlstand und Zusammenhalt auf der Anbetung des Mammon, der Plünderung der Natur und der Ausbeutung der Armen beruht. Aber da sind wir noch nicht. Vielleicht ist dieses Gebet aus Daniel 9 ein Schritt in die richtige Richtung und eine Hilfe, uns der Wirklichkeit unseres gemeinschaftlichen Versagens zu stellen.
Ach Herr, du großer und Furcht einflößender Gott, der den Bund und die Gnade bewahrt denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, wir haben gesündigt und sind schuldig geworden, wir haben gefrevelt und sind abgefallen, und von deinen Geboten und deinen Rechtssatzungen sind wir abgewichen.
Und wir haben nicht auf deine Diener, die Propheten, gehört, die in deinem Namen geredet haben zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vorfahren und zum ganzen Volk des Landes. Du, Herr, bist im Recht, uns aber steht die Schande ins Gesicht geschrieben…






 …
…

 chwarzer Humor also.
chwarzer Humor also.