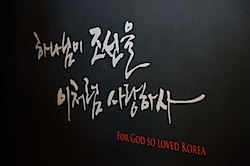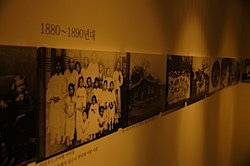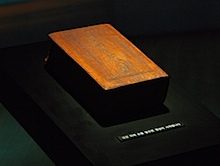manchmal versäumt man es, sich von jemandem zu verabschieden. Dann schreibt man dem anderen eine Nachricht – auf einen Post-It Zettel am Kühlschrank, eine Postkarte vom Reiseziel, auf Facebook oder eine schnöde e-Mail und holt das nach. Ich wünschte, ich könnte das jetzt auch tun und es käme bei Dir an, und Deine Antwort käme irgendwann zurück. Darum verabschiedet man sich ja: Ich gehe jetzt weg, aber ich bleibe auch in der Ferne mit Dir verbunden und ich freue mich schon, dass wir uns dann wieder sehen.
Ich würde Dir dann schreiben, wie schwer es mir auch nach ein paar Tagen noch fällt, mir vorzustellen, dass wir uns diesseits der Ewigkeit nicht mehr sehen werden. Dass ich, wenn ich nachts aufwache, immer noch eine Sekunde lang denke, ob nicht morgen früh die Sonne aufgehen kann und dann klingelt vormittags das Telefon und ich höre Deine Stimme, und Du erzählst von Deinem Urlaub in Frankreich und fragst, wann wir uns zusammensetzen und über die Pläne und Ideen reden können, die wir in letzter Zeit hatten. Und alles ist, wie es immer war. In diesen Momenten erinnere ich mich ganz genau an den Klang Deiner Stimme, an Dein Gesicht, Deine Gesten, Dein Lachen, wie Du Dich bewegst, was Dich freut, was Dir Sorgen macht.
Aber das ist nur noch ein Echo in meiner Erinnerung, und ich fürchte im selben Moment, wo ich es höre, auch schon, dass es irgendwann, viel zu schnell verblasst und in immer weitere Ferne driftet. Lass mich also jetzt gleich, ohne noch mehr Zeit zu verlieren, laut und deutlich sagen, unauslöschlich aufschreiben, was Dich so besonders gemacht hat: Deine Liebe zum Leben und zur Natur, zu Wasser und Bergen, in denen Du aus dieser Welt versehentlich hinausgefallen und nicht mehr zurückgekehrt bist; Dein weites Herz für andere Menschen, den hilfsbereiten, freundlichen und einfühlsamen Umgang mit ihnen; Dein Bedürfnis, Beziehungen und Gemeinschaft zu stiften und zu stärken; Deine Geduld und Beharrlichkeit und das Auge für Kleinigkeiten, das Tüfteln an Details, Dein praktisches Geschick und Deinen Sinn für Gerechtigkeit – etwa im Schulsystem, von dem Du immer gefordert hast, dass es auch den Benachteiligten gerecht werden sollte. Und über allem Dein Hunger nach Gott und einem Leben, das seine Menschenfreundlichkeit und Güte widerspiegelt und andere inspiriert.
Gott. Er spielt in diesen Dingen eine so undurchsichtige Rolle. Warum-Fragen scheint er ungern zu beantworten, andererseits meidet er Trauer und Verzweiflung, Zorn und Schmerz auch nicht und macht keinen Bogen um Menschen, die davon ergriffen sind. Gut, Dir muss ich dazu nichts mehr sagen, ich stochere hier im Nebel, während ein paar Dimensionen weiter „oben“ bei Dir womöglich pausenlos das schönste Licht leuchtet. Sitzt Du jetzt mit Einstein und Heisenberg fachsimpelnd beim Kaffee, oder bist Du ins Basiscamp aufgebrochen mit den kühnsten Kletterern?
Der Faden meiner Erinnerungen wird dünner werden, und auch der Faden meiner Phantasie reicht nicht über die tiefe Kluft hinweg, die uns nun trennt. Verbunden sind wir in der Liebe zu dem, was Du immer geliebt hast und dem, der uns immer geliebt hat und in Ewigkeit liebt. Irgendwann zieht er den Schleier weg, der ihn und Dich und die kommende Welt jetzt noch verhüllt, obwohl sie räumlich vielleicht nur ein paar Nanometer weit weg ist. Diese alte Welt aber ist ohne Dich nicht mehr dieselbe.
So ist das mit diesem unvermittelten Abschied: Er webt Schmerz und Verbundenheit, Nähe und Entfernung zusammen. Ich denke heute, an Deinem 44. Geburtstag, dankbar an alles zurück, was uns verbunden hat. Und bin traurig darüber, dass ich es nicht noch viel bewusster genossen und tiefer geschätzt habe. Nichts in diesem Leben ist selbstverständlich. Dich zu kennen, hat zu den besten Dingen gehört, die das Leben zu bieten hat. Dich viel zu früh gehen zu lassen, ist bitter. Deine Träume aber sind nicht vergessen, sie leben bei uns fort, und hoffentlich tragen sie noch ein paar gute Früchte.
In liebevollem Andenken,
Peter


 Etliche waren da, viele haben etwas versäumt und manche haben inzwischen schon nach den Mitschnitten gefragt: Am Wochenende hatten wir
Etliche waren da, viele haben etwas versäumt und manche haben inzwischen schon nach den Mitschnitten gefragt: Am Wochenende hatten wir