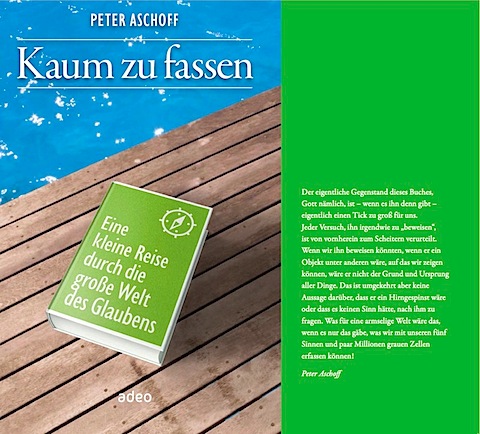Die Unterscheidung der verschiedenen Beziehungsräume bei Joseph Myers hat mich die letzten Tage begleitet. Eine ganz praktische Anwendung war, für jeden Raum eine Antwort auf die Frage zu formulieren, wie es mir geht.
Neulich rief der Verkäufer einer Autofirma an und fragte: „Wie geht es Ihnen?“ In Deutschland ist das ungewöhnlich, in den USA ganz normal. Wir kannten uns bis dahin gar nicht und es wird auch nicht Gegenstand unseres Gespräches sein. Ich habe maximal fünf Worte für eine Antwort. Ich bin gesund, wir haben keinen Trauerfall in der Familie, keine Naturkatastrophe in der Stadt, also sage ich „Danke, gut.“ Für den öffentlichen Raum ist das ganz authentisch.
Wenn ich dem Missverständnis erlegen wäre, ich müsse jetzt persönlich antworten (als wäre er mein Freund), dann hätte das für uns beide eine peinliche Situation ergeben. Amerikaner sind nicht oberflächlich, weil sie in einer solchen Situation nur allgemein und in der Regel positiv antworten, sondern ihre Antwort entspricht der Ebene, auf der sich die Beziehung für ihr Empfinden bewegt.
Am Freitag fragte mich dasselbe jemand, den ich mit Namen kannte. Wir treffen uns auf irgendwelchen Sitzungen ein oder zweimal im Jahr – sozialer Raum also. Ich sagte zwei allgemeine Sätze über meine Arbeit, mit der ich im Wesentlichen zufrieden bin. Da liegen unsere Berührungspunkte, insofern war auch das eine ganz authentische Antwort.
Gestern fragte mich ein Freund, wie es mir geht. Wir tranken etwas zusammen und es war Zeit, um länger zu antworten. Also konnte ich ein paar Dinge sagen, über die ich mich freue, und ein paar, die mir Sorgen machen. Einzelheiten dieses Gesprächs haben auf diesem Blog nichts zu suchen, der ist öffentlich zugänglich. Das steht im übrigen auch nicht auf Facebook (trotz der Formulierung „Freunde“) oder Twitter.
Wenn ganz enge Freunde oder meine Frau fragen, wie es mir geht, und wenn der äußere Rahmen dafür stimmt, wir also ungestört sind, nicht in einem Café sitzen, wo man uns am Nebentisch hört, wenn ausreichend Zeit ist, dann kann ich auch mal die ganz tiefen Dinge auspacken, die mir meistens erst dann richtig bewusst werden, wenn ich anfange, sie jemandem zu erzählen. Und da – aber nur da! – gehören sie dann auch hin.