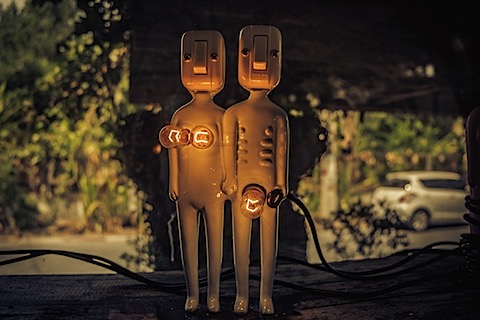Auf dem Greenbelt-Festival hat der geschätzte Theologe und Liederdichter John Bell sich letzte Woche öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt. Er verband dies mit der Erinnerung an Lizzie Lowe, die sich 2014 aus Angst und Scham das Leben genommen hatte. In den USA dagegen erschien das „Nashville Statement“ mit alten und neuen Verurteilungen.
Die beiden Beispiele zeigen, dass die Ressentiments und Verurteilungen, die Lizzie in die Verzweiflung getrieben haben, auch knapp drei Jahre später noch wirksam sind. Ich hatte kürzlich Kontakt zu einer Person, die ich lange aus den Augen verloren hatte. Ihr Coming Out vor einigen Jahren hatte zur Folge, dass sich viele Freunde und Weggefährten sang- und klanglos zurückzogen – als hätte es nie eine Beziehung gegeben, als wäre rückwirkend alles wertlos, was zuvor noch als verbindend erlebt worden war. Zum Glück reagierten so nicht alle, und zum Glück fand sich auch eine Gemeinde, die Homosexuelle nicht für unberührbar hält.
Aber was für ein schwerer Weg!
Ich habe mich ja über die Jahre auch immer wieder an dieser Diskussion beteiligt. Manches davon ist mir wieder durch den Kopf gegangen, als ich in den letzten Wochen den Grundkurs Ethik von Fischer, Gruden, Imhof und Strub (Zürich/Bern) las. Allzu oft, scheint mir, führt allein schon die formale Herangehensweise an die ethische Urteilsbildung dazu, dass sich nichts bewegen kann.
In dieser Herangehensweise hat sich für mein Empfinden oft sehr klar widergespiegelt, dass die eigentliche Fragestellung gar nicht die eines guten und verantwortlichen Umgangs mit Mitmenschen war, die eine andere sexuelle Orientierung haben, sondern die nach der eigenen Bibel- und Glaubenstreue. Deswegen treffen die Verurteilungen ja nicht nur eine bestimmte Praxis, die in den Kirchen bisher unüblich oder unterdrückt war, sondern auch alle, die eine andere Haltung dazu einnehmen.

Wenn man sich der eigenen Glaubenstreue vergewissern möchte, dann wird man in der Regel defensiv verfahren und den konservativen oder traditionalistischen Lösungsweg beschreiten: Da stellt sich zuerst die Frage nach der Norm, an der Glaubenstreue bemessen wird, nämlich Schrift und Bekenntnis bzw. in der römischen Kirche das kirchliche Lehramt und die Traditionen. In beiden Fällen geht es um normative Aussagen in Form von Texten. Texte, die möglicherweise als historisch entstanden gelten dürfen, deren zeitlose, allgemeine Verbindlichkeit aber zugleich auch immer schon vorausgesetzt wird. Was damals wahr und richtig war, kann heute nicht falsch sein (im Gegensatz dazu lässt sich durchaus sagen, was damals angemessen war, ist es heute nicht automatisch auch).
Nun sind dieselben Christen, die so defensiv argumentieren, durchaus in der Lage, an anderer Stelle situativ oder konsequentialistisch zu entscheiden und mit Normen flexibel umzugehen (oder nicht jede deskriptive Aussage der Schrift/Tradition gleich als deont(olog)ische Norm zu interpretieren). Auch wenn das Stichwort „Situationsethik“ meist verpönt ist, weil man irrtümlich unterstellt, damit ließe sich alles Mögliche zurechtbiegen. Diese Entscheidungsspielräume tun sich just in dem Moment auf, wo man sich nicht gleichzeitig auch noch der eigenen Glaubenstreue vergewissern muss. Beim Thema „Reichtum“ ist das zum Beispiel oft der Fall. Das gilt im konservativen Christentum tendenziell als Adiaphoron.
Also liefern die Exegeten einen biblischen „Befund“. Der fällt unweigerlich so aus, dass „Homosexualität“ (ein neuzeitlicher Begriff, der in der Bibel so nicht vorkommt) negativ konnotiert ist: Da, wo etwas erwähnt wird, was sexueller Aktivität unter Personen gleichen Geschlechts zugeordnet werden kann, sind ablehnende moralische Urteile anzutreffen. Diesen historischen Befund reicht man weiter an die systematischen Theologen, die im Grunde nur noch darüber diskutieren dürfen, wie freundlich oder schroff, mit wieviel verständnisvollem Bedauern und wieviel „prophetischer“ Schärfe man diese Norm nach außen und innen kommuniziert. Der Rest bleibt dann den Seelsorger*innen überlassen. Die sind nicht zu beneiden um diese Aufgabe.
Mir scheint, hier trifft zu, was Fischer & Co so formulieren: „Diese Debatte ist ein Beispiel dafür, dass die eigentliche Problematik vieler moralischer Fragen in der adäquaten Beschreibung steckt und nicht so sehr in der Begründung.“
Fast in jedem mir bekannten Fall, wo Christen ein solches Urteil zu revidieren in der Lage waren, kam eine persönliche Betroffenheit dazu, die die Frage nach der Glaubenstreue in den Schatten gestellt hat: Ein Familienmitglied, eine gute Freundin oder jemand, dessen Ernsthaftigkeit im Glauben ich nicht anzweifeln kann, ist von einem Ausschluss aus der Gemeinschaft betroffen. Der Schmerz darüber wiegt schwerer als die Sorge um den eigenen Status. Oder anders formuliert: Das ablehnende Urteil gegen jemanden, mit dem ich mich identifiziere, trifft auch mich. Ich denke jetzt mit ihm von einem anderen Ort her, von „draußen“. Das bisherige, konventionelle Urteil wird ausgesetzt und alles noch einmal neu beschrieben, durchdacht und abgewogen. Moralische Intuitionen kommen ins Spiel. Dreh- und Angelpunkt der Überlegung ist nicht mehr die kodifizierte Glaubensüberlieferung und die Frage nach der Richtigkeit, sondern die geliebte und geschätzte Person und deren Wohlergehen. Neue Sichtweisen auf biblische und kirchliche Aussagen werden möglich. Meistens erwachsen sie aus einer neuen Praxis, die sich in dieser Zwischenphase herausbildet, in der das Urteil ausgesetzt ist.
Fischer & Co nehmen in ihrem Grundkurs auf Luthers Freiheitstraktat Bezug. Dort ist es der Glaube, das Sich-Bestimmenlassen durch Christus, der den Menschen in seinem Verhältnis zu Gott von allem Rechtfertigungsdruck befreit. Der so befreite Christenmensch kann nun eben diese Freiheit nutzen, um selbstvergessen zu fragen, was für die/den Nächste(n) gut ist und wie man ihm/ihr gerecht wird.
Was die anderen, die sich mit Richtigkeiten beschäftigen, dazu sagen, ist dann egal.
Deswegen sind Menschen wie John Bell und die Zeichen, die sie setzen, so wichtig. Wir brauchen sie in den Kirchen und Gemeinden. Sie machen es auf die Dauer unmöglich, die Fragen unterschiedlicher sexueller Orientierung als etwas zu behandeln, das es nur irgendwo da draußen gibt, und es als Thema für interne Rechtgläubigkeitsdiskurse zu missbrauchen. Ich wünsche und hoffe, dass junge Christen bald genug solche Freunde und Bekannte haben, dass sie das alte Spiel nicht mehr mitspielen.