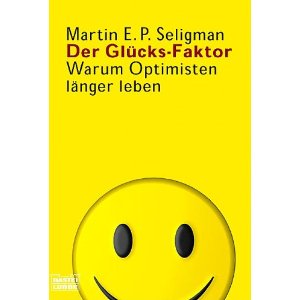Die Lektüre von Martin Seligmans positiver Psychologie bringt immer wieder kleine Erleuchtungen hervor. Zum Beispiel verstehe ich endlich diese immer wiederkehrenden Episoden, wo ein Kind aus der Schule kommt und – erst auf Nachfrage natürlich – verlauten lässt, die Lateinschulaufgabe sei gut verlaufen und eine entsprechende Note sei zu erwarten. Etliche Tage später stellt sich dann – jedesmal völlig überraschend! – heraus, dass der Lehrer die Sache offenbar anders sah und mit einer deutlich schlechteren Zensur bewertete. Auf Nachfrage erfahren die irritierten Eltern dann, dass irgendwelche unvorhersehbaren Dinge eingetreten seien – eine weitere Aufgabe auf der Rückseite des Angabenblattes, die man partout nicht habe sehen können, unerwartete Fragen zu Themen, mit denen man nie und nimmer habe rechnen können und derlei mehr.
Von Seligman habe ich inzwischen gelernt: Pessimisten schätzen sich exakter ein als Optimisten. Optimisten neigen dazu, sich zu überschätzen. Der Vorfall zeigt mir also, dass mein Kind Optimist ist. Pessimisten suchen zudem den Fehler für etwaiges Scheitern bei sich selbst und halten die Ursache für unveränderlich. Die Antwort meines Kindes auf die Frage nach den Ursachen zeigt, dass es den Grund des Scheiterns in einmaligen Zufällen sieht, die rein gar nichts mit ihm zu tun haben. Es geht daher mit demselben Optimismus in die nächste Prüfung.
Bisher hielt ich als typisches Exemplar der Mittelschicht den Mangel an Realismus für bedenklich, sah mein Kind fast schon abgehängt im Bildungswettlauf. Jetzt weiß ich, dass das eine Stärke ist. Denn insgesamt sind optimistische Menschen (und ich weiß genau, von wem sie diese Disposition geerbt haben…) leistungsfähiger, freundlicher und glücklicher. So ein paar Vierer oder Fünfer, würde Karlsson vom Dach sagen, die stören doch keinen großen Geist.