Man muss den Sinn des Gesetzes sehr gut kennen. Dann weiß man auch, wie man ihm auf angemessene Weise ungehorsam sein kann.
Richard Rohr zitiert den Dalai Lama
Man muss den Sinn des Gesetzes sehr gut kennen. Dann weiß man auch, wie man ihm auf angemessene Weise ungehorsam sein kann.
Richard Rohr zitiert den Dalai Lama
Die FAZ bringt einen Beitrag von Ben Macintyre zum Überleben im digitalen Zeitalter. Die Diskussion ob wir (um mit Isaiah Berlin bzw. Archilochos zu sprechen) Füchse oder Igel sind, also viele kleine Ansätze pflegen oder uns nur um eine einzige große Idee drehen, scheint entschieden. Der Fuchs hat gewonnen, mit allen Vor- und Nachteilen.
Nun kommt es darauf an, aus dem Überfluss angebotener Informationen das Wesentliche und Nützliche herauszufinden und Ablenkungen oder Wertloses zu ignorieren. Das erfordert eine andere Art des Denkens und Hinsehens. Und dafür hat Macintyre ein anderes, interessantes und griffiges Bild gefunden:
Dem Wissenschaftshistoriker George Dyson zufolge hatten die Nordwestpazifik-Indianer zwei sehr verschiedene Methoden, Boote zu bauen. Die Aleuten, die auf baumlosen Inseln lebten, bauten Kajaks aus Strandgut, indem sie Felle auf einen Rahmen aus Treibholz spannten. Die Tlingit hingegen fällten große Bäume und höhlten sie zu Kanus aus, indem sie das überschüssige Holz herausschlugen und -brannten.
„Früher waren wir Kajakbauer und haben Bruchstücke von Informationen gesammelt, wo wir sie fanden“, schreibt Dyson. „Heute müssen wir lernen, zu Einbaumbauern zu werden und unnötige Informationen zu verwerfen, um die verborgene Gestalt des Wissens freizulegen.“
Richard Rohr schreibt in Ins Herz Geschrieben über die Schwierigkeiten eines maskulinen Gottesbildes und der Notwendigkeit, auch weibliche Begriffe für Gott zu finden. Vor allem aber geht es ihm darum, diese Ebene der Reflexion wieder hinter sich zu lassen:
Bei aller Widerspiegelung patriarchaler Weltsichten zeigen die Texte der Bibel vor allem ein erstaunliches Desinteresse daran, überhaupt von Gott in der dritten Person zu reden (ob nun er, sie oder es). Was die Bibel sehr viel mehr umtreibt ist die Entdeckung, in der zweiten Person, um „Du“, mit Gott zu sprechen. (…) Manchmal kann die Beschäftigung mit dem korrekten Pronomen (…) für Gott eine dringend notwendige Korrektur sein, manchmal bringt sie aber auch zum Ausdruck, dass gerade diese Ich-Du-Beziehung vermieden wird.
Richard Rohr macht sich Gedanken über den Realismus der Bibel, und nachdem der Fasching vor der Tür steht, fand ich diesen Ausschnitt aus Ins Herz Geschrieben ganz schön:
Wir lesen in diesen Büchern von Sünde und krieg, Ehebruch und anderen Affären, von Königen und Mordaktionen, von Intrigen und Betrügereien – also von den ganz gewöhnlichen wunderbaren und traurigen Ereignissen des menschlichen Lebens. diese Bücher dokumentieren das Leben realer Gemeinschaften und konkreter gewöhnlicher Menschen, und damit sagen sie uns, dass «Gott zu uns in der Verkleidung unseres Lebens kommt» (…).
Aber für die meisten religiösen Menschen ist das wohl eine Enttäuschung. Offensichtlich würden sie es vorziehen, wenn Gott in ihren Gottesdiensten zu ihnen käme.
Für mich ist klar: Derzeit bildet sich eine Kirche heraus, die aus jedem Teil des Leibes Christi das Wertvollste einsammelt, was es an Weisheit in den verschiedenen Bereichen gibt: spirituelle Weisheit aus der Bibel, aus Meditation und Kontemplation, aus der Wissenschaft, aus dem politischen Ringen um Gerechtigkeit.
Richard Rohr, Ins Herz Geschrieben, S. 16
Die Zeit zur Beobachtung, dass ein Zusammenhang zwischen Geburtenrate und vitaler, also aktiv (!) gelebter Religiosität nachweisbar ist, während familienpolitische Maßnahmen weitgehend wirkungslos bleiben:
Wer den Glauben an die Familienpolitik verloren hat, aber zum Glauben an Gott nicht zurückkehren will, kann auch für eine massive Einwanderung plädieren und für eine rasche Aufnahme der Türkei in die EU.
Vielleicht hat die Differenz nicht nur mit dem Gehorsam gegenüber dem Gebot zur Fruchtbarkeit (oder gar dem Argwohn gegenüber Verhütung) zu tun – vielleicht funktioniert nämlich „seid fruchtbar!“ ebenso wenig wie das zitierte „sei spontan!“ – sondern mit einer Lebensperspektive der Hoffnung und der Überzeugung, dass Liebe nicht allein bleibt. Also weniger Gottes Forderung als vielmehr sein Vorbild?
Die Naturwissenschaftler stört wahrscheinlich am meisten, wenn Theologen Behauptungen über Jesus unter Bezugnahme auf bestimmte wissenschaftliche Theorien oder Entdeckungen zu beweisen versuchen, oder wenn sie bestimmte christologische Glaubensinhalte verwenden, um damit angebliche Lücken im Kenntnisstand der Wissenschaft zu füllen. Vermutlich stört es die Theologen am meisten, wenn die Naturwissenschaftler ihre angeblich neutralen Forschungsgebiete abschirmen, indem sie jeglichen religiösen Glauben als Trugschluss bezeichnen oder wenn sie versuchen, religiöse Erfahrung auf Faktoren zu reduzieren, die ihre eigene Disziplin lückenlos erklären könnte.
LeRon Shults, Christology and Science
Heute las ich einen Bibeltext, der, wie ich zunächst fand, den Mund gehörig voll nahm bei der Beschreibung der Wende, die Jesus für die Welt und das Leben der Christen (nein, aller Menschen) gebracht hat. Meine eigene Erfahrung und der Vergleich mit dem, was Menschen um mich her erleben, erschien mir in dem Augenblick weit hinterherzuhinken. Spontan war mir mehr danach, Gott darum zu bitten, dass er uns hilft, die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu verringern.
Dann wurde mir plötzlich bewusst, dass es so gar nicht gemeint war. Ein Wortspiel aus dem Englischen fiel mir ein: „Not an expectation to live up to, but a promise to live into“. Und genau das ist es! Auch zwischen Zuspruch und Wirklichkeit besteht noch eine Kluft, aber sie wird dadurch geschlossen, dass wir auf dem Weg bleiben, dem Zuspruch vertrauen und uns immer wieder die Verheißungen vor Augen halten. GInge es um einen Anspruch, dann stellte sich sofort die Schuldfrage: Wer trägt die Verantwortung dafür, dass meine persönliche Erfahrung nur ein fader Abklatsch dieser Aussagen ist? Aber Gott und die biblischen Autoren legen uns hier keine Latte vor die Nase, die wir nur überspringen oder reißen können, sondern sie bauen uns ein Sprungbrett. Die Kluft ist erst dann ein Problem, wenn ich nicht mehr springen will.
Es geht dabei auch um die Richtung der Zeit. Der biblische Zuspruch blickt vom herrlichen Ende zurück und sieht den Sonnenaufgang auf den Gesichtern derer, die ihm entgegen gehen. Von hinten betrachtet, aus der Perspektive dessen, der noch auf dem Weg (oder erst am Anfang des Weges ist) verdunkeln wir bloß den Schimmer am Horizont. Aber wenn irgendetwas mit dieser Welt – und mit mir – besser werden soll, dann muss ich mir diese Perspektive der Verheißung schenken lassen, die im Senfkorn schon den großen Baum sehen kann.
… und dann auch noch in der Welt. Chapeau! Diesen Artikel über zunehmend undifferenzierte, derbe Islamkritik, deren Exponenten brutalstmöglich formulieren und sich obendrein von irgendwelchen „politisch Korrekten“ verfolgt fühlen, sollte jeder lesen. Ganz, daher hier kein auszugsweises Zitat.
(Und als Deutscher lohnt der Blick in die Schweiz, wo nach den Minaretten nun deutsche Hochschullehrer zu Sündenböcken der SVP geworden sind. Die Geister, die man ruft…)
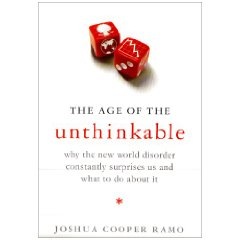 In den letzten Wochen habe ich von Joshua Cooper Ramo The Age of the Unthinkable: Why the new world disorder constantly surprises us and what to do about it
In den letzten Wochen habe ich von Joshua Cooper Ramo The Age of the Unthinkable: Why the new world disorder constantly surprises us and what to do about it gelesen (deutsch: Das Zeitalter des Undenkbaren
). Die Anregung hatte ich im Blog von Alan Roxburgh gefunden. Es erinnert etwas an die Bücher von Malcolm Gladwell wie Blink!: Die Macht des Moments
und Tipping Point: Wie kleine Dinge Großes bewirken können
, nur geht es um viel ernstere Fragen: Wie überleben wir in einer immer unberechen- und unbeherrschbaren Welt?
Vielleicht finde ich die Zeit, einige der Punkte, die Cooper Ramo stets mit Anekdötchen garniert serviert, zu rekapitulieren. Er geht der Frage nach, warum Militäraktionen im Irak und Afghanistan scheitern, warum Israel die Hisbollah mit seinen Angriffen stärkt statt schwächt und was man gegen die Bankenkrise hätte unternehmen können.
Notgedrungen stammen viele Themen aus dem Bereich Militär und Sicherheit. An einem bin ich als Theologe jedoch hängen geblieben. Er beschreibt die Diskussion unter Nato-Strategen über eine indirekte Kriegsführung: Statt die Truppen des Feindes direkt zu treffen, bombardiert man die Treibstofflager. Oder wirft Metallstreifen über Belgrad ab und blendet die serbische Flugabwehr, um als nächstes die Stromversorgung zu treffen und die Lichter auszuknipsen. Die Idee ist nicht neu, schon der chinesische Stratege Sunzi hat um 500 v.Chr. ähnliche Ideen und riet unter anderem, die direkte Konfrontation nach Möglichkeit zu vermeiden. Hingegen konzentriert sich westliches Denken und Strategie fast ausschließlich auf den direkten Schlag.
Nachdem mich das Thema diese Woche schon anderweitig beschäftigt hatte, habe ich mich gefragt, ob man nicht den Sieg Christi am Kreuz nicht ähnlich verstehen kann. Ein „direkter Schlag“ hätte den Palast des Kaiphas, die Präfektur des Pilatus und das Kapitol in Rom treffen können, aber einem Hohenpriester wäre ein weiterer gefolgt, ebenso einem Kaiser ein anderer und der Statthalter wäre noch leichter zu ersetzen gewesen. Die feindlichen Systeme hätten sich regeneriert, nichts hätte sich verändert. Alle ausradieren wäre auch keine Alternative gewesen, aber das ist ja zum Glück seit Noah schon klar.
Stattdessen zielt Gott indirekt – und gewinnt. Wenn wir Kolosser 2,15 lesen, dann bekommen wir einen Eindruck davon, was geschah:
Erstens entzieht Gott den „Mächten“ (und das verstehen wir eben am besten systemisch) die Legitimation. Er entzaubert sie, er nimmt ihnen den göttlichen Nimbus, der das Kaisertum (und die Tempelhierarchie) umgab. Denn er erklärt durch die Auferweckung das ergangene Urteil für null und nichtig. Bis dahin war es so etwas wie ein säkularer Staat praktisch undenkbar. Seither kann kein Herrscher, kein Regime, keine Institution mehr uneingeschränkte göttliche Autorität beanspruchen ohne sich damit zugleich als Götze zu entlarven.
Zweitens nimmt er den Mächten ihre entscheidende Waffe. Bislang konnten sie mit Verbannung und dem Tod drohen. Wer gegen die Staatsräson handelte, wurde geächtet, musste ins Exil oder wurde gewaltsam beseitigt. Nun fehlt dem Tod der Stachel, die Drohgebärde wird hohl. Denn außen vor dem Tor der Stadt wartet der auferstandene Christus bei den Vogelfreien und an den Gräbern der Dissidenten.
Wer bisher empfand, dass er keine Wahl hatte, hat sie nun zurückbekommen. Wir können mit den Mächten gegen Gott kämpfen und verlieren, oder gegen die Mächte verlieren und mit Gott gewinnen. Und hin und wieder werden wir Zeugen, wie eine dieser Mächte ins Stolpern gerät, strauchelt, und in sich zusammenfällt. Beispiele gab es genug in der Geschichte.
Das Kreuz – wenn wir es denn verstehen – immunisiert Menschen gegen den Anspruch der Mächte unser Leben letztgültig zu bestimmen, wie auch gegen die Angst, die sie verbreiten. Sie sind zu Pappkameraden geworden. Gott greift das Böse nicht frontal an, aber er gräbt ihm das Wasser ab. Allerdings geht der Kampf weiter. Eine andere Geschichte, die Cooper Ramo erzählt, ist die von Dr. Tony Moll, der in Tugela Ferry bei Durban ein AIDS-Projekt leitet. Der Erfolg rührt daher, dass er HIV-Infizierte als Trainer einsetzt. Oft sind sie selbst Analphabeten, aber sie helfen anderen Patienten, die Wirkung der AIDS-Medikamente zu verstehen und wir richtig anzuwenden. Dagegen haben teure, staatlich organisierte Programme gegen TB häufig versagt, weil sie auf Profis und Spezialisten setzen und den Patienten wenig zutrauen und zumuten.
Christen – egal welche – sind in gewisser Hinsicht wie die Patienten von Dr. Moll. Sie kennen die Krankheit, sie sind im Prozess der Heiljung begriffen und nehmen die Medizin selbst immer noch. Daher können (oder sollte ich das im Konjunktiv schreiben?) sie anderen auch ganz gut erklären, wie sie selbst kuriert werden und sich ihrerseits für eine gesunde Welt einsetzen.
Die Allianz-Gebetswoche ist zwar schon fast vorbei, aber eben habe ich diese Sätze von Walter Wink wieder gelesen:
Gebet ist kein Gesuch, dass an einen allmächtigen König gerichtet wird, der alles zu jeder Zeit tun kann. Es ist ein Akt, der den Ursprung, das Ziel und den Prozess des Universums befreit von den Verzerrungen, Vergiftungen, Verwüstungen, falschen Richtungen und dem puren Hass auf alles, was ist, der Gottes Absichten im Wege steht.
Wenn wir beten, schicken wir keinen Brief an ein himmlisches Weißes Haus, wo er auf einen Stapel mit anderen gelegt wird. Wir beteiligen uns vielmehr an einem Schöpfungsakt, in dem ein kleiner Sektor des Universums sich erhebt und lichtdurchlässig wird, hell glühend, ein vibrierendes Kraftzentrum, das die Kraft des Universums ausstrahlt.
Die Geschichte gehört den Betern, die die Zukunft in Existenz glauben. Wenn das so ist, dann ist Fürbitte alles andere als eine Flucht vor dem Handeln, sondern ein Weg, der auf Aktion zielt und sie herbeiführt.
Walter Wink, Engaging the Powers. Discernment and Resistance in a World of Domination, Minneapolis 1992, 303f
Heute auf Zeit Online: Theologische Deutungen des allmächtigen Google, zum Beispiel dieser Entwicklung vom Deismus zur „Inkarnation“:
… bislang störten sich nur wenige am Google-Gott, der alles von uns weiß, der jeden unserer Schritte sieht und dank des neuen Google-Handys immer bei uns ist, uns führt »an der lieben Hand«. Denn dieser Gott war ein abstrakter Gott, sein Reich waren die fernen Rechnerzentralen. Nun aber erscheint er uns, wird Auto, wird Kamera – wird bedrohlich.
Im gleichen Artikel ein frecher Vergleich von Florian Illies: Google als Sinnbild des nüchternen, auf Wissen und Worte reduzierten Calvinismus und der sinnlichen-ästhetischen Erfahrung, die Apple als Analogon zur katholischen Kirche vermittelt. So hatte ich das bisher noch nie gesehen…
PS: Etwas realitätsnäher und ganz untheologisch schreibt die Zeit hier zum Erfolg Apple
Der Häftling aus Zelle XV legte die Zeitung kopfschüttelnd zur Seite. „Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Diese Zwischenbilanz ist bestenfalls Kreisklasse. Ich habe mehr von ihm erwartet.“
„Wieso,“ fragte der Zellennachbar aus XIV durch die Gitterstäbe, „er hat doch keine schlechte Presse?“
„Ja, aber er kommt nicht so recht aus dem Knick“, antwortete der Typ mit dem wilden Bart und den lange Haaren. „Er scheint noch üben zu müssen für den großen Wurf. Und er verkrümelt sich in der Provinz, weit im sicheren Norden.“
„Na, sicher sieht anders aus, bei den vielen Rebellen dort im Hügelland“, hielt der andere dagegen. „Irgendwann werden sie sich sammeln und nach Süden ziehen.“
„Ob das für uns beide noch reicht? Die scheinen uns vergessen zu haben. Kein Wunder, aus diesen dicken Mauern dringt ja auch nichts nach außen. Ich frage mich allmählich, ob ich einem Schauspieler auf den Leim gegangen bin. Wenn er wirklich unser Mann wäre, säße ich dann noch hier? Ich meine, lies doch mal diesen Bericht: Ich kenne kaum die Namen der Käffer, die dort aufgezählt werden.“
Der aus XIV ließ sich die Zeitung durchs Gitter reichen. „Ich auch nicht“, sagte er nach einer Weile. „Und was mich noch mehr wundert: Er scheint die völlig falschen Leute zu rekrutieren.“
„Sag‘ ich doch“, grummelte der Bärtige. „Es sind jetzt schon acht Monate, dass sie mich hier eingesperrt haben. Langsam muss mal was passieren, sonst komme ich noch um in diesem Gemäuer. Die warten nur darauf, dass ich draußen vergessen werde, und dann bringen sie das zu Ende.“
„Du warst für mich immer der Größte“, sagte der andere. „Keiner hat denen da oben so deutlich die Meinung gesagt wie du. Und doch sind sie alle gekommen, um dich reden zu hören. Ich meine, sogar das Wachpersonal und der Alte erstarren noch in Ehrfurcht, wenn du den Mund aufmachst. Deswegen kommt er ja immer wieder mal vorbei. das macht er bei keinem anderen von uns.“
„Ja, der Alte kommt vorbei. Aber Er hat mich anscheinend vergessen. Oder er ist zu schwach. So oder so ist es deprimierend. Ich dachte, zu zweit hätten wir eine reelle Chance, hier etwas zu reißen. Ohne ein gewaltiges Blutbad hätte uns niemand ausschalten können. Wir hätten uns die Bälle zugespielt: Ich übernehme den aggressiven Part, er gibt den Versöhner, das kann er besonders gut. Aber eben nicht mehr als das, wie man sieht.“
Der Bärtige wurde plötzlich still. Durch das Gewölbe drangen Stimmen an ihr Ohr, die allmählich näher kamen. Er lauschte angestrengt, dann hellte sich seine Miene auf: „Endlich! Das sind Simon und Philipp. Sie haben ein paar Nachforschungen angestellt für mich. Mal sehen, ob sie gute Neuigkeiten haben.“
Es klapperte, und ächzend schwang die schwere Tür auf. Zwei junge Männer kamen herein, hinter ihnen steckte ein Wärter den Kopf in den Flur und legte dann wieder den Riegel von außen vor. Die beiden sahen müde und etwas verstaubt aus. Als sich ihre Blicke mit denen des Bärtigen trafen, flackerte Unsicherheit auf. Der eine blickt zu Boden, der andere fuhr sich mit der Hand durch das Haar und räusperte sich umständlich.
„Habt Ihr ihn gefunden?“, fragte der Bärtige. Die beiden nickten, und mit einer kleinen Verzögerung bestätigte Philipp: „Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob Dir seine Antwort gefällt.“
Es ist das Jahr 29, Herodes Antipas (der „Alte“) hat Johannes der Täufer in der Festung Machärus inhaftiert. Jesus unternimmt nichts, um Johannes zu befreien. Wenig später wird der Täufer hingerichtet. Ob er an Jesus verzweifelte oder ob ihn die Antwort Jesu aus Mt 11,2-6 tröstete, erfahren wir nicht. Wer möchte, kann hier weiter hören.
… sagte neulich ein Anrufer, als er mir von einer Entscheidung seines Gremiums berichtete, die ewig gedauert hatte und dann ein bisschen enttäuschend ausgefallen war. Nein, ich bin erwachsen, ich nehme das natürlich nicht persönlich. Das heißt, ich habe es dem Anrufer nicht persönlich verübelt und weiß, dass niemand im Gremium das böse gemeint hatte, als man so entschied, wie man entscheiden musste.
Aber natürlich steckt da eine – wenn auch indirekte – persönliche Botschaft drin, nämlich die: Hier geht es im Grunde gar nicht um Personen, sondern um das System, das nur Fälle und Funktionen kennt und dessen größte Sorge ist, keinen Präzedenzfall zu produzieren, der die Ordnung stören würde. Wenn es gut geht, wirst Du als Fremdkörper im System mit einem Perlmuttmantel überzogen und darfst irgendwo schillern.
Heute habe ich es andersherum erlebt: Ich nahm an einem Gespräch teil, in der ein Verantwortlicher eines Werkes sich größte Mühe gab, einem Interessenten (nicht mir…) gerecht zu werden, sich in seine Situation hineinzudenken, ihm entgegenzukommen, Brücken zu bauen, das Tempo anzupassen. Und ich dachte mir erleichtert: Na bitte, es geht ja doch. Vielleicht noch nicht überall, aber wenigstens hier und da!