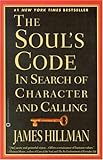Gestern hat mir Daniel den Link zur zweiten Ausgabe von Glauben und Denken geschickt, weil dort N.T. Wrights „Surprised by Hope“ rezensiert wurde. Ich habe das Magazin mit wachsendem Unmut quer gelesen und bin so langsam dabei zu verstehen, was mir da etwa bei Michael Horton so unangenehm aufstößt.
Um zum Kern der Sache zu kommen: Ich fürchte, hier wird das klassisch reformierte Anliegen, die Souveränität Gottes über alles zu stellen, in einer Art und Weise durchgezogen, die Gottes- und Nächstenliebe eben nicht mehr als gleichrangig behandelt. Mit schwerwiegenden Folgen, denn nun gerät das Engagement für den Nächsten (da wo Liebe also konkret wird, und sie muss konkret werden) unter Generalverdacht. Nicht die müssen sich rechtfertigen, die nichts tun, sondern die Engagierten, weil sie den Nächsten womöglich etwas zu sehr lieben.
Die Sorge ist, dass die Nächstenliebe zum Versuch wird, sich um die Gottesliebe herumzumogeln. Ich halte das schon praktisch für abwegig, denn nie bin ich auf Gott mehr angewiesen, als wenn ich einen unvollkommenen Nächsten lieben muss, obwohl der zum Beispiel Calvinist ist 🙂 Ich hatte vor 25 Jahren mal ein Buch aus mit ähnlichem Ansatz (Johan Bouman, Der Glaube an das Menschenmögliche), das die kirchliche Friedensbewegung eher undifferenziert als pelagianisch verurteilte und unterstellte, dass man den Himmel auf Erden aus eigener Anstrengung schaffen wollte.
Klar gibt es das auch hin und wieder. Aber so wie Konservative gern den Begriff „Gutmensch“ als semantische Keule auspacken, wenn sie mit ihrem Law-and-Order Ansatz in der Defensive sind, so wird hier all jenen, die sich konkret um Gerechtigkeit bemühen (nebenbei werden noch der Heilige Franziskus und Rick Warren mißbilligend zitiert), tendenziell unterstellt, sie würden das aus den falschen Motiven tun (und damit letztlich gegen Gott arbeiten). Und das natürlich, weil sie dem Zeitgeist oder einer weltlichen Ideologie anhängen und die reine Lehre verlassen haben.
Vielleicht bin ich jetzt unfair, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass Leute, die so etwas schreiben, vielleicht doch ganz zufrieden damit sind, wenn wir alle unser Sündersein betrauern, erschaudern angesichts der Heiligkeit Gottes – und nichts weiter. Die reine Lehre scheint, vielleicht ohne es tatsächlich je auszusprechen, zu sagen, dass wir eh nichts machen können gegen die Bosheit der Welt. Wer das anerkennt, beschränkt sich auf die Verbreitung dieser Erkenntnis (heißt es deshalb nur „Glauben und Denken“?) und geht das Risiko erst gar nicht ein, beim Helfen die unausweichlichen Fehler zu machen. Oder der Vorsehung Gottes ins Handwerk pfuschen zu wollen.
Aber ist das Ganze nicht die Folge einer nicht minder ideologischen, antipelagianischen Paulusfixierung mit einem Schuss dialektischer Theologie, die vielleicht gerade noch die johanneische Bruderliebe zulässt, bei der für die Gleichnisse Jesu aber eigentlich schon kein Platz mehr ist? Der barmherzige Samariter glaubt eh schon das Falsche und die Reinheit seines Verhältnisses zu Gott wird in dem Gleichnis gar nicht thematisiert – sie spielt keine Rolle. Der Punkt, um den man bei Jesus schier nicht herumkommt, ist der: Echte Nächstenliebe ist Gottesliebe und umgekehrt.
Wenn Ron Kubsch am Anfang Jesajas Ruf nach Gerechtigkeit zitiert – um sich dann gleich wieder auf den Ruf (d.h. die Verkündigung der Wahrheit) zu konzentrieren, und nicht die konkrete Gerechtigkeit für Arme und Unterdrückte – frage ich mich: wozu muss man sich dann auf diesem Weg eigentlich ständig wieder theologisch ein Bein stellen, wenn man das ernst meint?