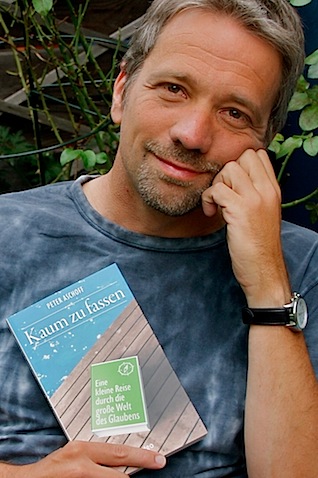Vorgestern war ich zu einem Treffen eingeladen, wo wir versucht haben, diese beiden Begriffe zusammenzubringen. Vielleicht war die Runde ein bisschen zu groß, die das Zentrum Mission in der Region da zusammengebracht hatte. Während die offizielle Ergebnissicherung noch aussteht, habe ich beschlossen, hier mal mein persönliches Fazit in ein paar unausgegorenen Thesen festzuhalten:
1. Wesen und Ziel von Mission
Zum Missionsbegriff ist viel geschrieben worden. Ich bevorzuge ein weites, ganzheitliches Verständnis. Mission ist mehr als nur die Predigt des Evangeliums, sondern auch der Dienst am Nächsten und das Eintreten für soziale und ökologische Gerechtigkeit.
Aber selbst in der weitesten Fassung muss man gleichzeitig festhalten: Mission ist nur das, wo sich Kirche und Christen nicht mit sich selbst beschäftigen. Das ist im großkirchlichen Kontext schwer zu definieren, wo Kirchenmitgliedschaft und Getauftsein sich mit sehr unterschiedlicher Nähe und Distanz zum Glauben verbinden.
Mission hat ihr Ziel erst dann wirklich erreicht, wenn Menschen aktiv an dieser Bewegung teilnehmen, die Gottes liebendes und rettendes Handeln an der Welt beschreibt (richtig verstanden führen Taufe und/oder die Erfahrung von „Bekehrung“ zu diesem Ziel). Wollte man über Erfolgskriterien oder Ergebnisqualität nachdenken, so müsste man ansetzen bei Fragen wie:
- hilft sie Menschen, zum Glauben zu finden und diesen auch selbst wieder weiterzugeben?
- nehmen die nach außen gerichteten Aktivitäten in einer Gemeinde zu?
- finden wir Partner in anderen Gruppen (und Glaubensgemeinschaften), mit denen wir soziale und ökologische Anliegen gemeinsam verfolgen?
- wird unsere Stimme in der Gesellschaft wahrgenommen?
2. Charakter von Mission
Hier geht es, das habe ich gestern gelernt, um die Prozessqualität. Ich hatte vorgeschlagen, sich am biblischen Ethos der Gastfreundschaft zu orientieren. Ganz knapp formuliert hat „gute Mission“ für mich fünf Aspekte; ich versuche, weitgehend positiv zu formulieren:
- Die Bereitschaft, selbst zum Fremden zu werden – sich durch die Identifikation mit Christus in eine Distanz zur eigenen (auch und gerade kirchlichen) Kultur führen zu lassen, starre Identitäten erschüttern zu lassen und deren Grenzen zu überschreiten um des Nächsten willen.
- Auf den Nächsten, der mir als Fremder begegnet, zuzugehen und ihn mit seinen Bedürfnissen wie mit seinem Reichtum sehen zu lernen
- Einen Freiraum (Zeit, Kraft, Aufmerksamkeit) zu schaffen, der frei ist von Erwartungs- und Anpassungsdruck (bzw. von allen Versuchen, andere zu beeindrucken, zu manipulieren oder zu übertrumpfen)
- Eine „freundliche Leere“ (H. Nouwen) zu pflegen, indem ich mich selbst zurücknehme und ein echter, ergebnisoffener Dialog und gegenseitiges Lernen möglich wird
- das freimütige, fröhliche und unapologetische Bekenntnis des eigenen Glaubens an den dreieinigen Gott bzw. der eigenen Glaubensgeschichte mit Gott im Rahmen der großen Geschichte Gottes mit der Welt.
Hier wird „Qualitätssicherung“ vor allem darin bestehen, auf die Rückmeldungen des jeweiligen Gegenübers zu hören. Darüber hinaus kann man sich selbst fragen (und das am besten von Jahr zu Jahr und dann die Antworten vergleichen):
- Wo bewegen wir uns als einzelne und gemeinsam über das gewohnte und vertraute Terrain hinaus?
- Wo gelingt es uns, Distanz zu überwinden und Vorbehalte bei uns selbst und anderen abzubauen?
- Wie klar ist unsere Vorstellung von unserem Beitrag zum Wohl des Gemeinwesens?
- Wo lassen wir die Beschäftigung mit eigenen Bedürfnissen und dem eigenen Erfolg bleiben um des anderen willen und pflegen Kontakte?
- Welche Spannungen nehmen wir dafür in Kauf?
- Wie kultivieren wir Achtsamkeit und Gelassenheit?
- Wie ist es um unsere Sprachfähigkeit im Blick auf den Glauben bestellt und welche Formen (Belehrung, Appell, Apologie, Bekenntnis/Zeugnis) bevorzugen wir dabei?
Oft sind hier nur relative Bewertungen möglich: Mehr/weniger (bzw. besser/schlechter) als vor einem Jahr, vor drei Jahren, vor zehn. Die jedoch können enorm sinnvoll und hilfreich sein. Man könnte schließlich auch noch die Frage der Strukturqualität aufwerfen: Aus- und Weiterbildung des Personals, Ausstattung mit Mitteln, angewandte Methoden.
Ich gestehe, dass ich das immer noch mit einem mulmigen Gefühl niederschreibe. Die Ökonomisierung so vieler Bereiche des gesellschaftlichen Lebens droht auch in den Kirchen großen Schaden anzurichten, wenn man nicht sehr umsichtig mit den Begriffen und Methoden des Managements verfährt. Ich rede zum Beispiel viel lieber von „Identität“ als „Marke“ zu sagen. In dieser Hinsicht musste ich mir beim Gespräch öfters auf die Zunge beißen. Die meisten Leute, die ich kenne, sind heilfroh, wenn in ihrer Gemeinde nicht auch noch die ganze Zeit von Effizienzsteigerungen und ähnlichen Dingen die Rede ist.
Kleiner Nachtrag: Mission ist eine Art Liebesaffäre. Kein Wunder, wenn man Hemmungen verspürt, in Herzensangelegenheiten Qualitätskriterien anzulegen.