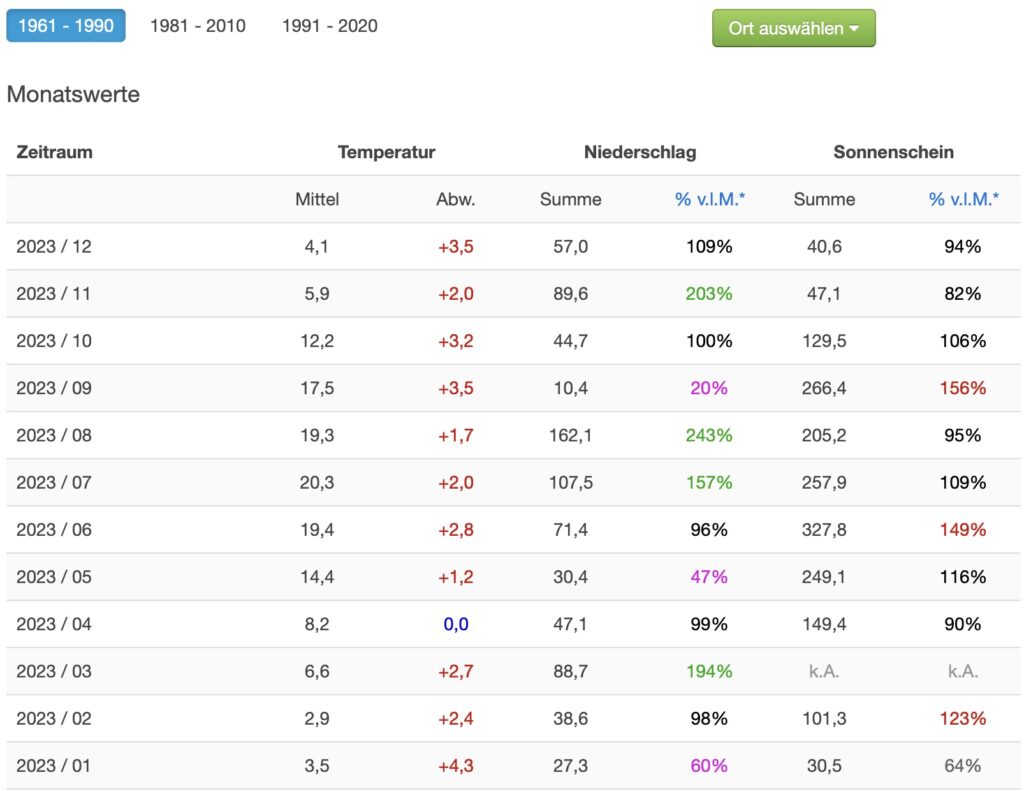Letzte Woche war ich auf dem St. Cuthbert’s Way unterwegs durch die Cheviot Hills in Northumberland. Der kräftige Westwind schob immer mal wieder eine Wolke heran, aus der etwas Sprühregen fiel. Dann kam die Sonne wieder heraus, und der Wechsel wurde mnachmal von einem Regenbogen begleitet. Ich blieb stehen, machte ein Foto, und ließ mich dann weiterpusten.
Zeitgleich bewegte sich der Hurrikan „Melissa“ mit unfassbaren 300 km/h Windgeschwindigkeit auf die Bahamas zu. Inzwischen hören wir von „apokalyptischen“ Verwüstungen, die in dem ohnehin schon armen Land stattgefunden haben.
Das haben fast alle mitbekommen. Weniger schlagzeilenträchtig war die Nachricht, dass – ebenfalls zeitgleich – in der vietnamesischen Stadt Hue 1.085 mm Regen innerhalb von 24 Stunden fielen. Über tausend Liter pro Quadratmeter! Zum Vergleich: Nürnberg hat einen Schnitt von 832 mm im Jahr.
Während ich den Regenbogen anschaue, geht an zwei anderen Orten die Welt unter. Nicht die ganze Welt, klar, aber die Welt der Menschen, die dort leben, eben schon. Und heute, am 2. November lesen wir aus dem Buch Genesis, wie Gott verspricht:
Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
Wir haben neulich einen Schulgottesdienst gefeiert mit einer improvisierten Arche, vielen, vielen Stofftieren und darüber einem Tuch in Regenbogenfarben. Eine der Mitwirkenden sagte nachdenklich: Schon grenzwertig, wie wir das entschärfen. Aber es sind ja Kinder…
In diesem Satz aus der Sinflutgeschichte spiegeln sich die Lebensbedingungen des Holozän wider, der letzten 12.000 Jahre. Relativ stabile klimatische Muster, mit nur wenigen Schwankungen. Das ist inzwischen vorbei, und die Ereignisse der vergangenen Woche unterstreichen das erneut. Das Anthropozän hat begonnen, oder noch etwas präziser: das Kapitalozän. Das Zeitalter der „Männer, die die Welt verbrennen“, um mal einen aktuellen Buchtitel zu zitieren, oder des „Petromaskulinismus“ – auch eine treffende Bezeichnung. Erobern und ausplündern ist die Devise. Mit Konzernen, die mehr Kohle haben als mancher Nationalstaat. Jemand schlug vor, Wirbelstürme künftig nach Firmen zu benennen – Gazprom, Aramco oder Exxon. Und mit Superreichen, die ihr Jahresbudget an Emissionen dieses Jahr schon am 11. Januar verbraucht haben und seither ökologisch auf Kosten aller anderen leben.
Vor ein paar Wochen kam die Nachricht, dass „wir“, diese extrem ungleiche Weltgemeinschaft, inzwischen sieben von neun planetaren Grenzen überschritten haben. In diesem Jahr hat nun auch die Versauerung der Ozeane die kritische Schwelle überschritten. Das ist in etwa so, wie wenn der Arzt mir sagen würde, dass mein Herz schwächelt, die Lungen vom Rauchen geschädigt sind, die Zuckerwerte schlecht, die Leber überlastet und noch drei niederschmetternde Diagnosen.
Alle Prognosen aus den vergangenen Jahrzehnten über Erderhitzung und Anstieg der Meere sind eingetroffen oder übertroffen. Wir wissen es, aber wir glauben es nicht. Und die Entwicklung beschleunigt sich weiter. Trotzdem: Viele Entscheidungsträger verleugnen und verschleppen mögliche Lösungen und viele Wähler:innen lassen sich einreden, der Klimaschutz bedrohe unsere Lebensweise, nicht der nahende Kollaps der lebenserhaltenden Systeme unserer Erde. Die Durchschnittsbüger und -konsumenten machen in einer Mischung aus Hilflosigkeit, Lethargie und Ignoranz erst mal weiter wie bisher.
Kann man in dieser Situation ersnthaft davon ausgehen, dass Gott das Ruder noch herumreißt und mit unsichtbarer Hand den globalen Thermostat herunterdreht? Die Erzählung von der Sintflut legt nahe, dass wir damit nicht rechnen können:
Erstens geht es in der Zusage Gottes ja explizit darum, dass er die Erde nicht zerstört. Dass wir Menschen das tun würden, ist für die Verfasser dieser Texte gar nicht denkbar gewesen.
Und zweitens greift Gott in der Bibel nicht über die Köpfe hinweg ein, sondern durch Menschen. Immer. Noah, Abraham, Mose, die Prophetinnen und Propheten. Manchmal dauert es, bis er jemand findet. Schließlich wird er selbst Mensch, um sich unübersehbar auf die Seite der Leidenden und Schwachen zu stellen und die Saat für eine neue Weltordnung zu legen, in der es nicht mehr ums Erobern und Ausplündern geht. Nicht über die Köpfe hinweg, sondern durch menschliche Köpfe, Herzen und Hände hindurch bewirkt Gott diese Veränderung der Welt. Und deshalb ist sie oft so unscheinbar und verletzlich.
Unmittelbar vor der Sintflut ist eine Notiz über Göttersöhne und Riesen eingefügt. Die Göttersöhne nehmen sich Menschenfrauen – heißt auch: Es gibt keine Göttertöchter. Göttersöhne sind keine biologische Spezies, sondern eine soziale Klasse: Die Großkönige der Antike – die Superreichen von damals, die sich ihre Gesetze schreiben lassen, die die Öffentlichkeit manipulieren, für die alles zum Objekt wird, bei Frauen angefangen und weiter über alle, die schwächer sind als sein selbst. Hatte die Sintflut also auch den Sinn, diese Übermächtigen aus dem Spiel zu nehmen?
Wenn wir vom ersten ins letzte Buch der Bibel springen, dann finden wir eine mögliche Antwort auf diese Frage. In Offenbarung 11 sind die sieben Siegel geöffnet und die siebte Posaune ist erschallt. Im himmlischen Thronsaal erklingt fröhlicher Gesang. Er hat damit zu tun, dass Gott im Tumult der Weltgeschichte seine Herrschaft aufrichtet und Gerechtigkeit schafft. Der entscheidende Satz in diesem Zusammenhang lautet:
»Und wer die Erde zugrunde richtet,
wird selbst zugrunde gehen.«
Nicht die Welt geht unter in der Offenbarung, wohl aber geht die Zeit derer zu Ende, die sie verwunden und zerstören. Es ist nicht das Ende aller Dinge, sondern es sind die Geburtswehen einer neuen, besseren Welt. Aber die existiert bisher nur ganz punktuell. Daher brauchen wir Propheten, die sie uns ausmalen, und Lieder, die das tief in unser Herz und unseren Geist hineintragen.
Der Songpoet Jackson Browne schrieb im Jahr 1974 ein prophetisches Lied: Before the Deluge – Vor der Flut. Er veröffentlichte das im Jahr der Ölkrise und zwei Jahre, nachdem der Club of Rome mit bemerkenswertem Weitblick auf die Grenzen des Wachstums hingewiesen hatte. Im Gegensatz zu vielen anderen Texten aus dieser Zeit haben Browns eindringliche Worte nichts an Aktualität verloren. Es ist einer der ersten ökologischen Protestsongs und eine apokalyptische Warnung.
Er singt von Idealismus, Scheitern und Resignation im Bemühen, ein stimmiges Verhältnis von Mensch und der übrigen Natur zu erreichen. Schließlich wehrt die sich selbst und zeigt den Menschen ihre Grenzen auf.
Some of them were angry
At the way the earth was abused
By the men who learned how to forge her beauty into power
And they struggled to protect her from them
Only to be confused
By the magnitude of her fury in the final hour
Im Kollaps und danach bleiben dann die kleinen Dinge: Kinder und Bedürftige schützen, Musik machen und alles andere, was uns tröstet und Mut gibt, durchzuhalten.
Now let the music keep our spirits high
And let the buildings keep our children dry
Let creation reveal its secrets by and by, by and by
When the light that's lost within us reaches the sky
Im Singen und Klagen, im Hören und Helfen können wir schon mal anfangen, uns darauf einzustellen, dass manches weniger wird und vieles schwerer. Aber dass zugleich auch das Ende der modernen Riesen und das Gericht über ihre Maßlosigkeit und Dominanz kommt.
Damit wir dann handeln können und nicht hadern müssen.