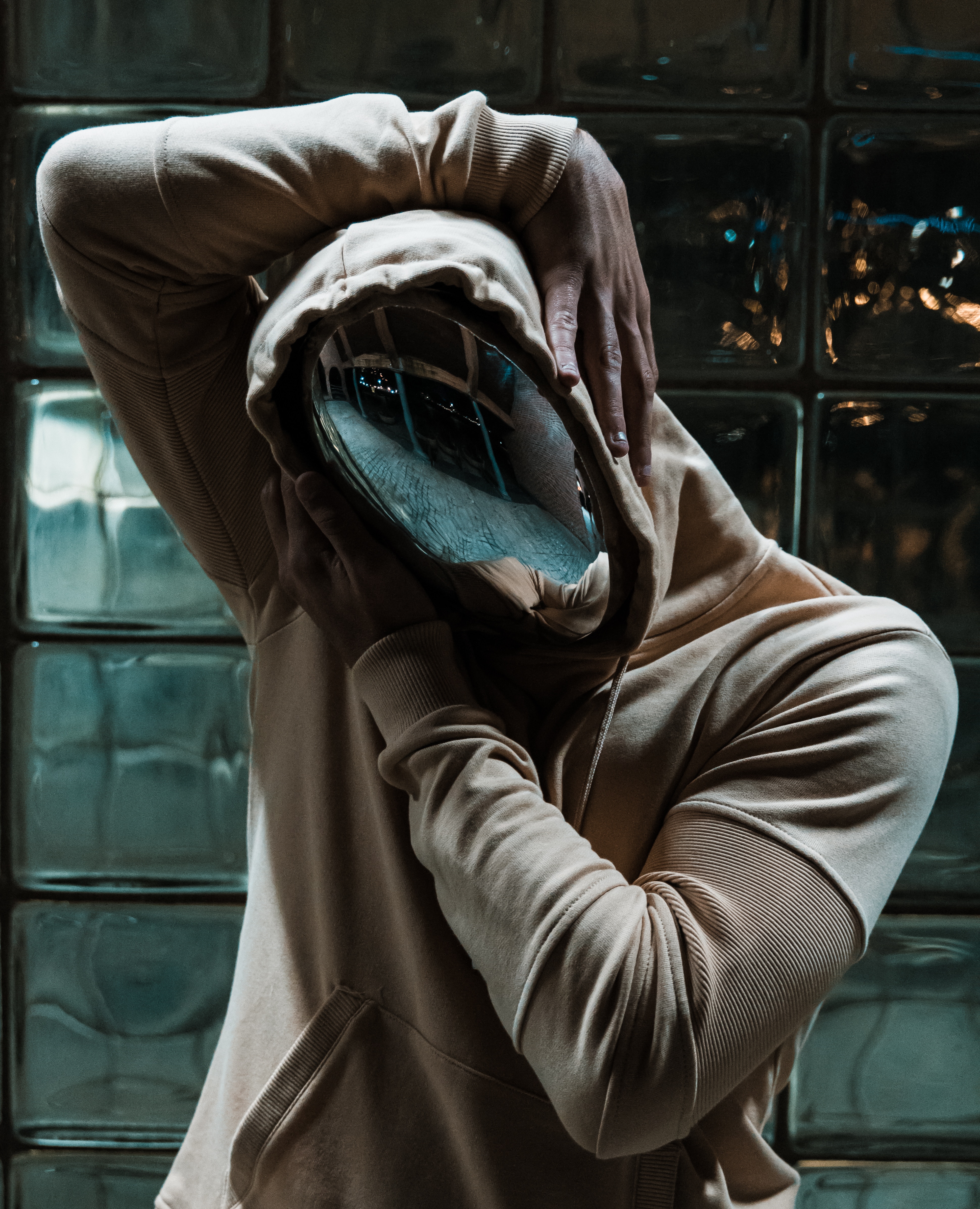Die Weihnachtsgeschichte lässt sich aus den unterschiedlichsten Perspektiven betrachten und erzählen. Die weihnachtliche Lesung aus dem 2. Samuel 7 bringt zum Beispiel König David ins Spiel. Ich fragte mich beim Lesen: Wie hätte David wohl die Geburt Jesu von Nazareth erlebt? Was wäre ihm dabei durch den Kopf gegangen, wenn er hätte zuschauen dürfen?
(Vielleicht hat er ja tatsächlich…?)
Ich stelle mir das ungefähr so vor: Irgendwo in den himmlischen Wohnungen geht ein Engel den Flur entlang, klopft an einer Tür, wartet eine Weile und öffnet sie dann vorsichtig. Aus dem Zimmer hören wir laute Musik – sie erinnert verdächtig an Leonhard Cohens berühmtes „Hallelujah“ –, die mitten im Lied abbricht. „Ja, bitte, was gibt’s?“ fragt eine Stimme.
„Ich sollte doch Bescheid sagen, David, wenn es so weit ist“, sagt der Engel. „Der Countdown läuft bereits, in ein paar Minuten geht es los. Die Live-Übertragung hat schon begonnen. Der Allmächtige hat Dir einen Platz in auf der Kommandobrücke freigehalten. Stell deine Harfe in die Ecke und komm mit.“
„Augenblick, Metatron“, sagt David, „ich muss nur schnell noch diesen magischen Akkord notieren, dann bin ich so weit.“ „Beeil dich“, sagt der Engel, „Was du gleich siehst, reicht garantiert für mindestens hundertfünfzig neue Psalmen!“ Und wenige Augenblicke später eilen der Engel und David den Flur entlang Richtung Kommandobrücke, die ein bisschen wie Raumschiff Enterprise aussieht. Dort angekommen, nehmen sie auf zwei Sesseln Platz, und Metatron sagt: „Bild auf Schirm eins, bitte!“
Ein großer Bildschirm leuchtet auf und von oben sieht man das Tote Meer, den See Genezareth, Jordantal, Hügelland und Sinai-Halbinsel. „Ihr habt die Sessel erneuert, seit ich das letzte Mal da war“, sagt David. „Ist ja auch schon eine Weile her“, antwortet Metatron. „Stimmt,“ sagt David, „ich konnte lange nicht mehr hinsehen. Es war einfach zu deprimierend. Mach mal das Bild größer, ich erkenne noch gar nichts.“
„Kommt schon“, sagt Metatron. „Jetzt kannst Du schon einzelne Hügel und Ortschaften erkennen. Das große oben am Bildrand ist Jerusalem.“ „Ach Jerusalem. Wenn ich gewusst hätte, wie schnell meine Nachfolger das herunterwirtschaften und wie die Babylonier schließlich alles platt machen, dann hätte ich mir nicht so viel Mühe gegeben mit dem Bauen.“
Metatron antwortet: „Inzwischen sieht es wieder recht imposant aus.“ „Ja“, sagt David, „aber das war doch alles dieser Gauner Herodes. Am kaiserlichen Hof in Rom gibt er das Schoßhündchen, das Augustus (der hält sich übrigens für einen Gott, wusstest du das?) aus der Hand frisst, und bei seinen eigenen Leuten ist er als übler Schlächter verschrien. Das einzige, was er wirklich kann, ist Geld für seine Protzbauten auf den Kopf zu hauen. Das mag ich mir nicht anschauen. Irgendwann baut er noch einen Turm, der an den Wolken kratzt und schreibt seinen Namen in goldenen Buchstaben drauf. Aber sag mal, was ist der andere Ort da unten, der jetzt näher kommt?“
„Das ist Bethlehem“, sagt Metatron. „Bethlehem!“ seufzt David. „Lange habe ich es nicht mehr gesehen. Groß ist es geworden! Und jetzt erkenne ich auch die Hügel wieder. Da, hinter diesem Olivenhain, habe ich immer unsere Schafe gehütet. Eine schöne Zeit war das! Das ganze Leben war noch so gemächlich. Abends hatte ich Zeit zum Harfe spielen, ich musste keine Lageberichte lesen, Steuerlisten erstellen, Ernennungsurkunden unterschreiben – dieser ganze Verwaltungskram kann einem das Königsein ja wirklich vermiesen. Und guck mal, da stehen ja immer noch Schafe. Ganz wie früher. Seh’ ich das richtig: Brennt da ein Feuer, und ein paar Hirten sitzen daneben?“
In diesem Moment geht die Türe auf. Mose und Elija kommen herein. Mose stellt eine Schale mit Manna-Chips auf den Tisch und Elija eine Flasche Wein vom Berg Karmel. „Oh, Hirten und Schafe!“ sagt Mose, als sein Blick auf den Bildschirm fällt. „Meine besten Erinnerungen. Nicht halb so anstrengend, wie später die Israeliten 40 Jahre durch die Wüste zu scheuchen. Aber wer sind die anderen Leute da im Bild?“
Metatron erklärt: „Er heißt Joseph, sie Maria. Sie suchen gerade noch ein Nachtlager. Es eilt ein bisschen, sie ist nämlich hochschwanger.“ Und David fügt stolz hinzu: „Wir sind übrigens verwandt! Joseph stammt aus meiner Familie, also ist auch das Kind, das bald zur Welt kommt, mein Nachkomme.“
„Na endlich, David“, sagt Elija. „Mit deinen Erben lief es ja nicht immer rund. Und was musste ich mich rumärgern mit Königen in Israel. Ein Friedefürst war gewiss nicht darunter. Dafür haufenweise Windbeutel: geldgierig, arrogant und nachtragend. Und das soll jetzt alles besser werden?“
„Allerdings,“ gibt David zurück, „das hat Nathan ja damals schon prophezeit: Einer kommt, der die Krone wirklich verdient hat. Und der behält sie dann auch.“
Elia schaut etwas verwundert: „Apropos Krone: sehr vornehm schauen die zwei ja nicht aus…“
Metatron hält dagegen: „Na gut, aber David war’s ja auch nicht, bis Samuel ihn fand.“ „Genau,“ sagt David, „und zwar bei den Schafen, da unten.
Mose runzelt die Stirn und zeigt auf das Bild: Jungs, wer sorgt denn nun für die Sicherheit da unten? Ich meine ja nur. Als Kind wäre ich fast umgebracht worden. So etwas vergisst man nicht!“
„Wissen wir doch, Mose. Aber die Kollegen vom SEK sind gleich vor Ort“, beruhigt ihn Metatron, und Elija fragt: „S-E-K? Wofür steht das bitteschön?“
„Singendes Engel-Kommando“, antwortet Metatron. David will wissen, ob die Engel eines von seinen Liedern singen, Der Herr ist mein Hirte würde doch gut passen. Aber Metatron meint, sie wurden gebeten, etwas Neues zu schreiben für diesen besonderen Anlass.
Elija stellt fest, dass das Bild nun schlechter ist, weil es allmählich Nacht wird in Bethlehem. Mose greift zu seinem Stab und teilt das Bild mit einer energischen Bewegung. In der linken Hälfte erscheinen Maria und Joseph jetzt groß und deutlich. Mose kommentiert: „Endlich haben sie einen geschützten Ort gefunden. Was ist das – eine Höhle? Oder eher ein Stall? Müssen sie sich verstecken? Vor den Ägyptern vielleicht?“
„Die Ägypter sind keine Gefahr mehr,“ meint Metatron, „aber Herodes hat überall seine Soldaten. Und der steckt mit den Römern unter einer Decke.“
David kratzt sich fragend am Kopf: „Wohnt denn Joseph nicht in Bethlehem?“ Und als er hört, eine Volkszählung des Kaisers habe die beiden hergebracht, wird er noch nachdenklicher. Er sagt: „In meinem ganzen Leben war Gott nie so zornig über mich wie damals, als ich eine Volkszählung ansetzte. Denn wer so etwas tut, braucht Geld oder Soldaten oder beides. Der Kaiser wird sich noch wünschen, er hätte das bleiben lassen.“
Während David noch in Gedanken versunken ist, ruft Mose plötzlich laut: „Hey, da drüben bei den Hirten blitzt und blinkt der Himmel!“ Ein Engel erklärt, das sei das SEK, angeführt von Metatrons Bruder. Der sei früher in der Abteilung für Polarlichter gewesen. Metatron seufzt: „Leider trägt er gern etwas dick auf. Seht, jetzt muss er den Hirten schon wieder sagen, dass sie sich nicht fürchten sollen.“
David spitzt die Ohren: „Wie schön sie singen! Klingt doch fast wie eines von meinen Liedern, oder? Diese himmlischen Stimmen sind umwerfend gut. Plötzlich zweifelt man nicht mehr, dass Frieden auf die Erde kommt, wenn man so einen Gesang hört.“
Mose unterbricht ihn: „Seid mal still. Ich höre da noch ein anderes Geräusch…“
Tatsächlich, irgendwo schreit ein Baby.
Elija sieht es als erster: „Maria – Sie hat das Baby gerade bekommen, schaut nur! Jetzt wickelt sie es in ein warmes Tuch und hält es fest im Arm. Klein schaut er aus, unser Befreier.“
Mose findet: „Naja, wer hätte das von mir gedacht, als mein Körbchen im Nil schwamm, dass ich dem Pharao die Stirn biete? Und hätte deine Mutter beim Windeln wechseln davon geträumt, dass du einmal König Ahab samt Anhang in Bedrängnis bringen würdest, Elija? Gott fängt doch immer klein an.“
David wischt sich eine Träne der Rührung aus dem Auge. „Jungs, jetzt bin ich doch ein bisschen stolz. Ein Spross aus meiner Familie, bei meinen Leuten in meiner Stadt.“ Und Metatron antwortet: „Da kannst du wirklich stolz sein. Wusstest Du eigentlich, dass Maria auch singt und Lieder schreibt? Neulich habe ich ein Protestlied von ihr gehört, in dem sie davon rappt, dass Gott die Welt auf den Kopf stellt – Reiche gehen pleite und Großmäulern verschlägt es die Sprache. Der Song hat es auf Anhieb in die himmlischen Top Twenty geschafft. Singen jetzt alle hier.“
„Sie wird mir immer sympathischer“, findet David. „Am Ende kommt ja doch noch etwas Gutes aus meiner abgedrehten Sippe.“
Ein Engel erklärt Metatron, die Hirten seien auf dem Weg zu dem Neugeborenen und das SEK wolle dort noch einmal auftreten. Man habe ja schließlich lange geprobt für heute. Lieber kein Spektakel. Aber Metatron findet, der Kleine und seine Eltern brauchen Ruhe. Die Hirten sollten auch deshalb allein gehen, um unnötiges Aufsehen zu vermeiden. Es könne sonst zu gefährlich für ihn und die Familie werden…
Elija nickt sagt mit ernster Miene: „Tja, so ein Friedefürst lebt gefährlich unter all den Kriegsherren da unten. Besser, wenn sie noch nicht ahnen, was da auf sie zukommt. Er sieht aber auch wirklich sehr friedlich aus. (Flüstert) Ich glaube, jetzt ist er eingeschlafen.“
Mose lächelt: „Wenn er größer ist, gehen wir ihn mal besuchen, Elija. Am besten treffen wir uns auf einem hohen Berg. Mit Bergen kennen wir beide uns ja aus. Wie wäre der Tabor, der liegt ganz nahe bei Nazareth?“
„Machen wir“, antwortet Elija. „Apropos Berg, lass uns anstoßen mit dem Wein vom Karmel.“ Alle Versammelten erheben ihre Gläser: „Auf den Befreier! Auf den Sohn Davids!“
* * *
Zurück zu uns. Weihnachten, das heißt:
Gott schlägt ein neues Kapitel auf in der Geschichte der Welt.
Wie immer beginnt er klein. Winzig klein.
Wie immer sucht er Menschen, die sich auf ihn einlassen: Maria und Joseph, ein paar Hirten, drei Fremde.
Aber mit dem ersten Fuß, der er auf diese Erde setzt, wird auch deutlich, was neu ist: Die Geburt des verletzlichen Messias markiert den Anfang vom Ende der Gewaltherrscher.
„Das Wort wurde Fleisch und zog in die Nachbarschaft“, weiß der Evangelist Johannes. Gott riskiert alles, daher wird er auch nicht locker lassen, bis er sich durchgesetzt hat. Jetzt gibt es für ihn kein Zurück mehr. Was an Weihnachten geschehen ist, lässt sich nicht mehr aus der Welt schaffen.
Christus, so schreibt es Paulus später, ist das „Ja“ auf alle Verheißungen Gottes. Und ganz oben auf dieser langen Liste von Gottes Zusagen stehen, so singen es die Engel den Hirten auf dem Feld zu, Frieden und Gerechtigkeit für die Menschen seines Wohlgefallens, „große Freude“ für „alles Volk“. Zugleich ist er Gottes „Nein“ zu Hass, Verrat, Verleumdung, Misstrauen, Gewalt und Gleichgültigkeit unter Menschen.
Ganz egal, wie sehr sich der Welthorizont 2016 verdunkelt hat – wir feiern heute die Ankunft des Lichtes und erinnern uns daran: Das große „Ja“ ist gesprochen. Es gilt – immer noch, immer wieder, und ganz besonders allen, die sich in diesen Tagen klein und verletzlich fühlen.
Fröhliche Weihnachten!