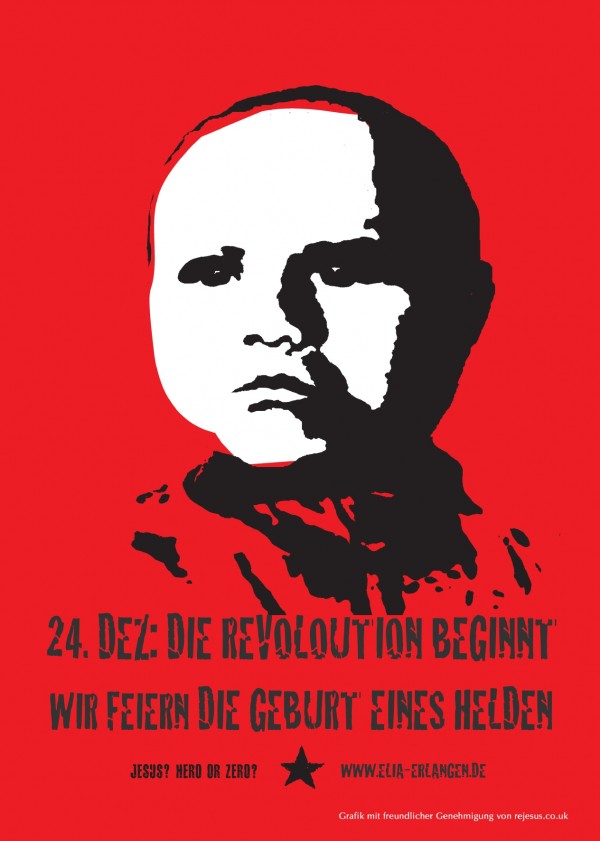vor ein paar Tagen las ich, dass Ihnen der Europäische Kulturpreis für Zivilcourage verliehen werden soll. Ihre Kritiker waren empört. Pazifisten, Feministinnen und viele andere Menschen im Land freuten sich. Kurz darauf machte die Nachricht die Runde, dass Sie den Preis abgelehnt haben. Die Empörten schwiegen irritiert, die Erfreuten schwiegen aus Hochachtung.
Dass Sie den Preis nicht angenommen haben, war richtig, Schließlich haben Sie im letzten Jahr – nach den (so die Stiftung) preiswürdigen Worten zu Afghanistan – einige schwere Fehler gemacht. Nein, ich meine nicht die Alkoholfahrt, sondern Ihren Umgang damit. Sie hätten nämlich auf die ersten Enthüllungen erwidern müssen, diese Vorwürfe seien „abstrus“. Das hätte Ihre Unterstützer mobilisiert und eine kleine Medienschlacht angezettelt. Es ist zwar schwer, einer so integren Institution des öffentlichen Lebens wie Bild irgendeine Parteilichkeit oder verdeckte Interessen zu unterstellen, aber einen Versuch wäre es allemal wert.
Natürlich hätte die Polizei der Öffentlichkeit irgendwann Beweise präsentiert. Bis dahin hätten Sie die Gelegenheit gehabt, alle kirchlichen Gremien davon zu überzeugen, dass man auf eine Lichtgestalt wie Sie unmöglich verzichten kann. Und dann hätten Sie gelassen an Schritt zwei der Bewältigungsstrategie herangehen können: Scheibchenweise Geständnisse längst bekannter Fakten in verharmlosender Sprache („Einzelfall“, „eventuell“, „hier und da“, „könnte sein“) mit umfangreichen Rechtfertigungen (Verweis auf Ihre vielen Aufgaben und die Schwierigkeit, sich zu erinnern; Anspielung auf Ihre Verdienste und den Stress damals zur Zeit der Führerscheinprüfung). All das natürlich nur vor ausgewählten Journalisten.
Schließlich hätten Sie kurz vor dem Prozess vor dem Verkehrsgericht ankündigen können, dass Sie Ihren Führerschein zurückgeben. Aus freien Stücken natürlich, und weil Sie bei genauerer Betrachtung zu dem Ergebnis gekommen sind, dass da „Blödsinn“ passiert sei. Allerdings nicht ohne den Hinweis, dass dieser Verzicht Sie schmerzt, und nicht ohne Seitenhiebe auf Gegner, die Ihnen die gebührende Demut abgesprochen hätten. „Wer ohne Knöllchen ist, werfe den ersten Steinhäger„, hätte das Sonntagsblatt titeln können, und dann Anspielungen auf Verkehrsdelikte anderer machen.
Ihre Hilfstruppen hätten sich daraufhin auf Facebook und vor den Mikrofonen der Journalisten davon beeindruckt gezeigt, wie mutig Sie Fehler einräumen und die mediale Hetzjagd auf Sie kritisiert. Anspielungen darauf, dass die Staatsanwälte in Hannover eine Landplage seien, erfolgreiche Menschen hassen und kirchenfeindlich gesinnt seien, wären auch eine Überlegung wert gewesen. Was auf keinen Fall fehlen darf, wäre der Hinweis, dass hier Männer versuchen, eine starke Frau zur Strecke zu bringen, oder Spekulationen darüber, ob denn die Rüstungslobby, die Sie mit ihrer Kritik am Krieg vergrätzt hatten, vielleicht auch den Alkomaten hergestellt (und womöglich frisiert?) hatte.
Der Rat der EKD hätte erklärt, dass man Sie als Bischöfin und nicht als Fahrerin gewählt hätte, dass Sie ohnehin selten selbst am Steuer sitzen und dass ein Führerschein keine Bedingung für kirchliche Ämter ist. (Fußnote: Wo war Ihr Fahrer eigentlich an diesem Abend – und könnte man ihn dafür vielleicht schnell noch feuern?) Und dann hätte jemand gesagt: Nichts ist gut in Deutschland, so lange wir uns hier über Fehler im Promillebereich ereifern, während in Afghanistan und anderswo Menschen sterben.
Und wo wir schon dabei sind: Eigentlich müsste die Öffentlichkeit doch dankbar sein dafür, wie Sie das Thema Alkoholmissbrauch und Risiken im Straßenverkehr wieder ins Gespräch gebracht haben! Womöglich werden so viele hundert, ach was, tausende schwerer Unfälle verhindert weil nach diesem Vorfall nicht nur Sie so vorbildlich in sich gegangen sind, sondern auch viele andere ihre Trink- und Fahrgewohnheiten geändert haben.
All das haben Sie unterlassen und damit bewiesen, dass Sie die deutsche Öffentlichkeit nicht verstehen, die lieber verbogene Helden als gar keine möchte, so lange die nur gut aussehen und jugendlich-dynamisch rüberkommen. Zivilcourage hat in der Kultur Europas doch nichts mit Mut zu tun, sondern mit der Dreistigk… Durchsetzungsfähigkeit, das Offensichtliche beharrlich kleinzureden, wegzulächeln und auf bessere Tage oder die Vergesslichkeit der Leute zu hoffen.
Dass Sie nun nicht etwa ihre Schwester oder einen Pressereferenten zur Preisverleihung in die Paulskirche schicken, sondern ganz verzichten, weckt dennoch Hoffnung. Es zeigt, dass Sie – spät, aber immerhin – die perfide Strategie der obskuren Europäischen Kulturstiftung durchschaut haben, die im Geiste von Wikileaks & Co einen gefährlichen Anschlag auf unsere Gesellschaft plant und einen Keil in die Beziehung zu wichtigen Verbündeten südlich der Alpen zu treiben versucht.
Sie zeichnen sich damit im Übrigen auch als wahrhaft konservative Denkerin aus. Und dafür lässt sich mit Sicherheit ein anderer Preis finden. Den sollten Sie dann mit einem gerüttelt Maß an Demut vor dieser unserer aller Kultur auch bitteschön annehmen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Peter Aschoff