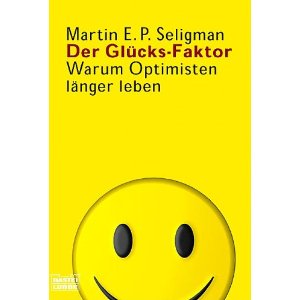Den nachfolgenden Text habe vor einer ganzen Weile für die Zeitschrift dran geschrieben. Weil die Ausgabe von damals die inzwischen in den Ablagen und Archiven schlummert, poste ich es hier als einen Beitrag zur „Helden-Diskussion“ der letzten Tage, nur ganz leicht überarbeitet.
Manchmal scheint das Klischee zu sein: Brave Männer kommen in die Kirche, böse überall sonst hin. Das Dauerthema „Identität der Geschlechter“ ist in unseren Gemeinden ständig präsent, selbst wenn es nicht ausdrücklich angesprochen wird. Generell stehen wir vor der Frage, wie wir mit einer zwar nachlassenden, aber an vielen Stellen eben noch spürbaren doppelten Schieflage umgehen: Oft noch relativ wenige Frauen in Leitungsfunktionen und oft gleichzeitig zu wenige Männer in den Gottesdiensten und bestimmten Arbeitsbereichen, denn nicht nur ein Kindergärten und Grundschulen, auch in den Kindergottesdiensten dominieren die Frauen. Kleine Jungs und junge, tatkräftige Frauen – beide finden zu wenig Vorbilder und Identifikationsfiguren. Ein Thema gegen das andere auszuspielen hilft also nicht weiter. Wenn ich im Weiteren hier über die Frage schreibe, was mit den Männern los ist, dann darf das nicht als indirekte Klage über eine „Verweiblichung“ der Gemeinden verstanden werden.
Sind christliche Männer also nur fromme Weicheier, die „echte“ Männer abschrecken, oder „flüchten“ die eher vor der Überzahl der Frauen? Ein Freund ist beruflich aus der Gemeinde in die Wirtschaft gewechselt. Dort trifft er viele Männer, die ein großes Bedürfnis haben, über den Glauben zu reden. Aber die Gemeinden in seiner Region sprechen sie einfach nicht an.
Die Bibel gibt uns keine direkten Anweisungen, was zu tun ist, um mehr Männer zu „erreichen“. Aber vielleicht sollten wir der Frage nachgehen, ob wir das Evangelium so weit privatisiert haben, dass viele Männer finden, für ihre Lebenswirklichkeit spielt es keine Rolle – es sei denn, sie sind (und das ist jetzt nicht ironisch gemeint) gerade im Erziehungsurlaub.
Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen an sich sind unerheblich:
Frauen werfen nicht so gut. Sie sind weniger aufgeschlossen für One-Night-Stands, neigen nicht so stark zu körperlicher Aggression und masturbieren seltener. Die anderen Differenzen fallen, statistisch gesehen, kaum ins Gewicht (Aus „Frauen sind auch nur Männer“ in: Zeit Wissen 01/2007).
Die sozial konstruierten und historisch geformten Rollen – und im Zusammenhang damit die verschiedenen Lebenswelten – sind der Knackpunkt: Wir haben ja auch herzlich wenig „Karrierefrauen“ in den Gemeinden, die keinen sozialen Beruf haben. Karriere machen fordert oft einen unangemessenen Tribut: Gesundheitlich, familiär und spirituell. Unsere Karrieremodelle an sich sind krank, für Männer und Frauen.
Predigtinhalte bewegen sich in der Regel im Bereich persönlicher Moral (Ehrlichkeit, Treue etc.) und wenn es dann wirklich mal „politisch“ wird, geht es um Familie oder Abtreibung – schon wieder ein „Frauenthema“. Über Arbeit und Beruf wird selten gesprochen, und wenn, dann geht es wieder oft um Moral, und für „typisch männliche“ Sünden (die haben zumindest in der Regel des Klischees mit Sex zu tun) gibt es dabei deutlich weniger Verständnis. Wirtschaftsethik fehlt dagegen, auch wenn Kapitalismuskritik seit der Finanzkrise schon mal im Nebensatz einer Predigt erscheint.
Unsere dominierende Metapher für Gemeinde ist die Familie. Nur bedeutet Familie im 21. Jahrhundert „Kernfamilie“ (wenn nicht gar „Rumpf-Familie“), also emotionaler Nahbereich. Das war im ersten Jahrhundert und bis vor wenigen Generationen noch ganz anders, auch wenn wir damals wie heute dieselben Begriffe verwenden. Viele Männer fühlen sich, gerade wenn sie einen Job mit Verantwortung haben, in der eigenen Familie aber schon fremd (ähnlich wie Kaufleute im Mittelalter, die Monate auf Reisen waren), folglich erst Recht in der Gemeinde.
Erschwerend kommt dann noch die ausgesprochen intime Lobpreiskultur dazu, mit viel Herz und erkennbar weniger Anforderung an den Intellekt. Das romantisierende Motto „In Love with Jesus“ mag für Frauen ja noch ohne Peinlichkeiten abgehen, aber auf die meisten Männer wirkt es schon etwas gewöhnungsbedürftig. Sie sitzen (zumindest in der Öffentlichkeit) auch nicht so gern „auf dem Schoß des Vaters“. Und das müssen sie auch nicht, denn in der Bibel wird die Liebe zu Gott weder zu romantischem Geturtel verklärt noch auf Babyniveau verniedlicht.
Im Griechischen ist ekklesia – das in unseren Bibeln mit „Kirche“ übersetzt wird – ein Begriff aus der Politik. Wir sind nicht nur Gottes Familie, sondern sein Volk. Diese weitere Dimension fehlt heute an vielen Stellen, wo das Evangelium auf Lebenshilfe im Beziehungsbereich reduziert wird. Dabei war es mal eine Botschaft, deren Träger wegen Hochverrats als Staatsfeinde hingerichtet wurden.
Heute beschränken sich viele Gemeinden auf das Private und Intime, sie ziehen sich aus dem öffentlichen Leben zurück – ein Trend, der geschichtlich gesehen in Freikirchen und im Pietismus besonders ausgeprägt ist. Und wegen manch missglückter Politisierung zur Rechten und Linken legt man in vielen Gemeinden Wert darauf, überhaupt nicht politisch zu sein, nach dem Motto, wer nichts macht, macht auch nichts falsch. Nur geht das doch gar nicht: Wenn wir zu den meisten politischen und gesellschaftlichen Themen schweigen, sagen wir damit indirekt, dass sie Gott egal sind. Und diese Botschaft wird sehr wohl verstanden!
Christliches Machotum oder fromme Cowboy-Erlebnispädagogik ist für mich keine ausreichende Lösung. Damit schafft man künstlich Reservate in einer immer noch widrigen Umgebung. Vermutlich helfen uns auch die autoritätslastigen, patriarchalischen Männerideale vom „Haupt der Familie“ nicht weiter, die bei vielen die normale Überforderung im Spannungsfeld Familie-Beruf-Gemeinde noch potenzieren.
Das Problem sind nicht die Männer („zu weich“, „zu hart“, „zu oberflächlich“) und auch nicht die Frauen („zu viele“, „zu stark“, „zu emanzipiert“). Das Problem ist, dass wir Glauben privatisiert, moralisiert und in einer ganz bestimmten intimen Tonlage emotionalisiert haben. Wir brauchen daher keine Testosteronbiotope, sondern einen grundlegenden Kulturwandel in den Gemeinden, der auch vielen Frauen gut tun wird: Wir müssen uns auf unsere komplizierte und unheile Welt einlassen, uns Fragen stellen, auf die man nicht sofort eine Antwort und die passende Bibelstelle dazu weiß. Sonst nehmen Männer uns – völlig zu Recht – nicht ganz ernst.