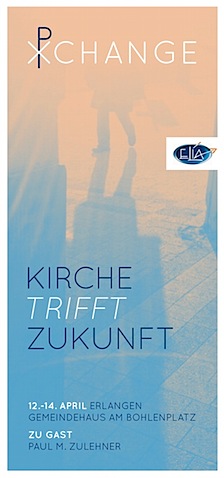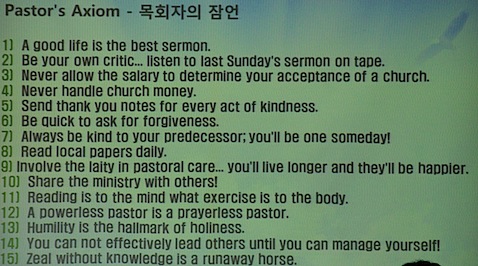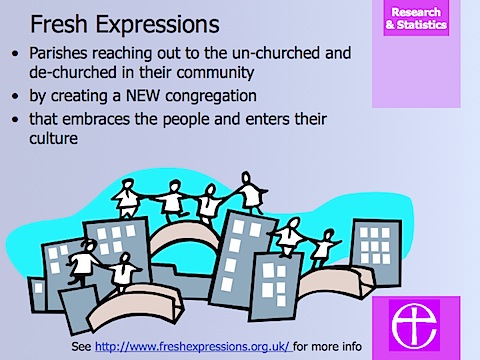In seinem Buch Missional Small Groups geht M. Scott Boren der Frage nach, welche Rolle Kleingruppen in einer Gemeinde spielen, die sich als missional versteht. Es ist weniger die große Theorie, sondern die vielen praxisnahen Ideen und Gedanken, die die Lektüre wertvoll machen. Und man muss etwas Übersetzungsarbeit leisten, nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell. Boren setzt mit einer Unterscheidung von vier „Typen“ ein. Wenn Menschen über ihre Kleingruppen berichten, dann hört er vier unterschiedliche Geschichten.
Man trifft erstens auf die Geschichte der persönlichen Verbesserung („personal improvenment“): Das Leben ist ein bisschen leichter, wenn man es mit ein paar Freunden bespricht. Man nimmt an der Gruppe teil, wenn es sich so einrichten lässt, dass alle anderen Lebensrhythmen (Arbeit, Familie, Freizeit) davon nicht betroffen sind. Es tut gut, anderen von sich erzählen zu können und miteinander zum Beispiel auch in der Bibel zu lesen.
Zweitens funktionieren Kleingruppen nach der Geschichte der Anpassung des Lebensstils („lifestyle adjustment“): Die einzelnen haben es zu einer Priorität gemacht, die Vorrang vor anderen Lebensrhythmen bekommt. Also werden Inhalte, Struktur und Verbindlichkeit ganz wichtige Themen, andere Aktivitäten der einzelnen stehen öfter hinten an, um an den Gruppentreffen teilnehmen zu können.
Drittens gibt es die Geschichte der gemeinschaftlichen Umorientierung („relational revision“). Hier ist nicht so sehr die Zeit im Blick, die man in den regelmäßigen Zusammenkünften miteinander verbringt, sondern die Frage, wie man einander unterstützt in der Gestaltung des Alltags, wie man Kontakt hält, für einander da ist und gemeinsam lernt, aus der ständigen Verbindung mit Gott heraus anders zu leben, als wenn man der Eigendynamik der einzelnen Lebensbereiche weitgehend freien Lauf lässt.
Und schließlich ist da noch die Geschichte der missionalen Neugestaltung („missional recreation“), die das Blickfeld noch mehr weitet. Die ist insofern schwierig zu beschreiben, als sich lauter einzigartige Gestalten entwickeln, denn die entscheidende Frage einer solchen Gruppe lautet, wie sie sich in ihrem Umfeld (sei es ein Dorf oder Stadtteil, eine bestimmte „Szene“ o.ä.) sinnvoll engagieren und auf vorhandene Nöte und Bedürfnisse eingehen kann. Je nach Umfeld und je nach Zusammensetzung der Gruppe kommt dann ein ganz anderer Rhythmus heraus.
Boren beschreibt auch gleich die unterschiedlichen Reaktionen auf seine Typologie. Da ist einerseits der verbreitete Wunsch nach „mehr“ und die Enttäuschung, dass sich das bisher so nicht umsetzen ließ. Andererseits ist da die Tendenz, besonders die beiden erstgenannten Selbstverständnisse einer Kleingruppe als defizitär abzulehnen. Drittens ist da das Gefühl der Überforderung: Wenn die Latte so hoch liegt, schaffen wir das nie. Die meisten werden gemischte Gefühle haben. Die gute Nachricht jedoch ist, dass das Umlernen, wenn es denn erwünscht ist, in kleinen Schritten vor sich gehen kann.