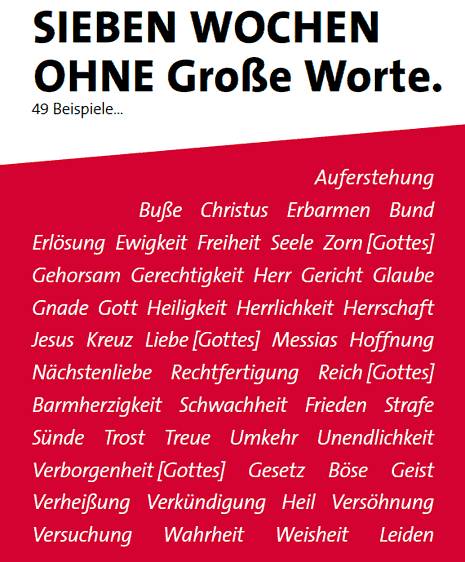Vor einer Weile bekam ich einen Beitrag aus Faszination Bibel zugesandt, der sich mit der Anweisung des Paulus befasst, Frauen hätten im Gottesdienst und in der Öffentlichkeit immer das traditionelle Kopftuch zu tragen. Die Überschrift lautet „Jeder Text ist ein Kind seiner Zeit“ und der Autor, Prof. Armin Baum von der FTA in Gießen, erläutert dort wunderbar verständlich und klar, was der Brauch (der in vielen patriarchalischen Gesellschaften heute noch existiert) damals bedeutete, um dann ebenso überzeugend zu schildern, inwiefern sich der gesellschaftliche Kontext so verändert hat, dass das Symbol (Kopftuch) seine Bedeutung (kein Interesse an intimen Beziehungen zu Männern) verloren hat.
Was Paulus selbst angeht, so hat er, wie mir scheint, an eine solche kulturelle Distanzierung seiner Anweisung gegenüber entweder nicht gedacht (Juden und Heiden waren in dieser Frage, wie der Artikel belegt, weitgehend einig) oder er sah verständlicherweise keinen Anlass, weil er ja auch nicht damit rechnen konnte, dass 2.000 Jahre später unter ganz anderen gesellschaftlichen Bedingungen jemand diesen Brief lesen würde. Aus dem Text wird deutlich, wie Paulus hier
- erstens christologisch argumentiert: „Ihr sollt aber wissen, dass Christus das Haupt des Mannes ist, der Mann das Haupt der Frau und Gott das Haupt Christi.“ (11,3),
- zweitens schöpfungstheologisch unter Anspielung auf Genesis 2: „Denn der Mann stammt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Der Mann wurde auch nicht für die Frau geschaffen, sondern die Frau für den Mann. Deswegen soll die Frau mit Rücksicht auf die Engel das Zeichen ihrer Vollmacht auf dem Kopf tragen“ (11,8-10),
- drittens das wackelige schöpfungstheologische Argument wieder christologisch relativiert durch den Verweis auf die Gleichrangigkeit der Geschlechter: „Doch im Herrn gibt es weder die Frau ohne den Mann noch den Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann stammt, so kommt der Mann durch die Frau zur Welt; alles aber stammt von Gott.“ (11,11-12)
- und viertens und letztens (d.h. aber auch als sein entscheidendes Argument!) in dieser Streitfrage die „Natur“ anführt und an den Verstand appelliert: Lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für den Mann eine Schande, für die Frau aber eine Ehre ist, lange Haare zu tragen?“ (11,14-15).
Die ebenfalls argumentativ ins Feld geführte Angelologie lasse ich einmal beiseite. Völlig zu Recht stand in Faszination Bibel, dass Paulus sich wohl sorgt, ein Aufgeben des Kopftuches in der Öffentlichkeit würde unvermeidlich zu falschen Schlussfolgerungen Anlass gegeben hätte. Wir heute hätten aber dafür – Baum spricht vom ethischen Prinzip der ehelichen Treue – andere Ausdrucksformen und Konventionen entwickelt, zum Beispiel den Ehering.
Paulus selbst aber schreibt hier nichts von dieser Sorge, die erschließt sich bestenfalls aus dem Zusammenhang. Sein Begründung liest sich für mich recht kategorisch: Schöpfungsordnung, Natur, Vernunft (alles Dinge, die heute in keiner Polemik gegen den vermeintlichen Ausverkauf des Glaubens an den Zeitgeist fehlen dürfen). Das wird im Falle des Kopftuches nun kulturell und kontextuell relativiert. Ich bin nicht ganz sicher, ob man zeitlose ethische Prinzipen und zeitgebundene Symbole tatsächlich so leicht auseinanderhalten kann, aber abgesehen davon stimme ich dieser Auslegung uneingeschränkt zu: Es ist kein Gebot der Natur, also keine biologische Notwendigkeit, sondern der Kultur, also ein gesellschaftliches Arrangement. Die antike Kleiderordnung ist keine Schöpfungsordnung.
Und jetzt denken wir das Ganze bitte einen wichtigen Schritt weiter:
Ich frage mich, wo jetzt noch der qualitative Unterschied zu Römer 1,26f. liegt, wenn Paulus hier wie dort mit dem damals gängigen philosophischen Naturbegriff argumentiert (der fehlt übrigens im Alten Testament) und mit „atimia“ („Unehre“) einen Begriff aus der alttestamentlichen Weisheit verwendet:
Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus: Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen; ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander; Männer trieben mit Männern Unzucht und erhielten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung.
Wo dieselbe Begründungsstruktur vorliegt, da können doch auch dieselben Fragen gestellt werden – in diesem Fall eben, ob nicht auch diese Aussage über das, was „natürlich“ ist, in hohem Maße zeit- und kulturbedingt sein könnte, und ob wir nach allem, was wir heute wissen, uns das Urteil („widernatürlich“, „Schande“) unbesehen zu eigen machen müssen. Von „müssen“ kann, wie der Vergleich zeigt, auch nach evangelikalen Maßstäben keine Rede sein. Leider wird das sehr oft so dargestellt, als gäbe es keinen Ermessensspielraum.
Das ist verstörend, zumal sich auch hier das allgemeine Empfinden (das die Christinnen in Korinth nicht verletzen sollten) ebenso gewandelt hat wie die wissenschaftliche Bewertung (eine seltenere Spielart menschlicher Sexualität, aber kein pathologischer „Defekt“ – schon gar kein mutwillig oder durch eigene/fremde Schuld herbeigeführter) und die gesellschaftlichen Verhältnisse (es gibt gleichberechtigte, verbindliche Partnerschaften unter Homosexuellen, was damals bei Juden, aber auch Griechen und Römern undenkbar war). Wollte man hier ein kontextunabhängiges „Prinzip“ ermitteln, dann wäre das die partnerschaftliche und fürsorgliche und treue Liebe.
Dass dies im einen Fall recht problemlos geht und im anderen zu so schweren Zerwürfnissen führen kann, lässt sich für mich nicht so sehr aus den Texten selbst erklären, sondern vielmehr aus den Macht- und Mehrheitsverhältnissen in den Gemeinden und Führungszirkeln der jeweiligen Konfessionen, wie auch der Tatsache, dass die Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft schon wesentlich weiter gediehen ist als die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften. In ein oder zwei Generationen könnte das also schon ganz anders aussehen.
Die Frage an alle, die heute Verantwortung tragen, bleibt: Warum nicht auch „b“ sagen, wenn man längst schon „a“ gesagt hat – um der betroffenen Menschen willen?