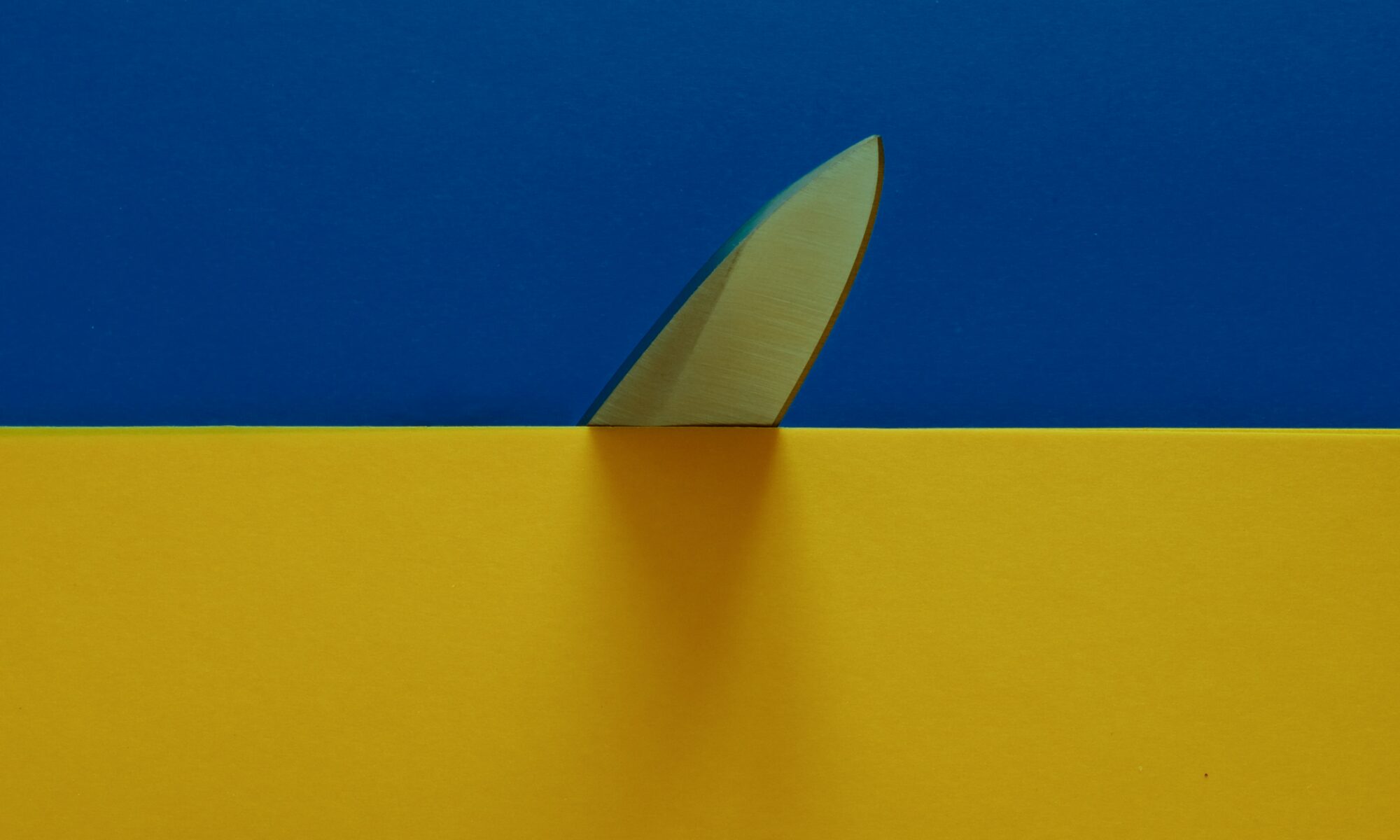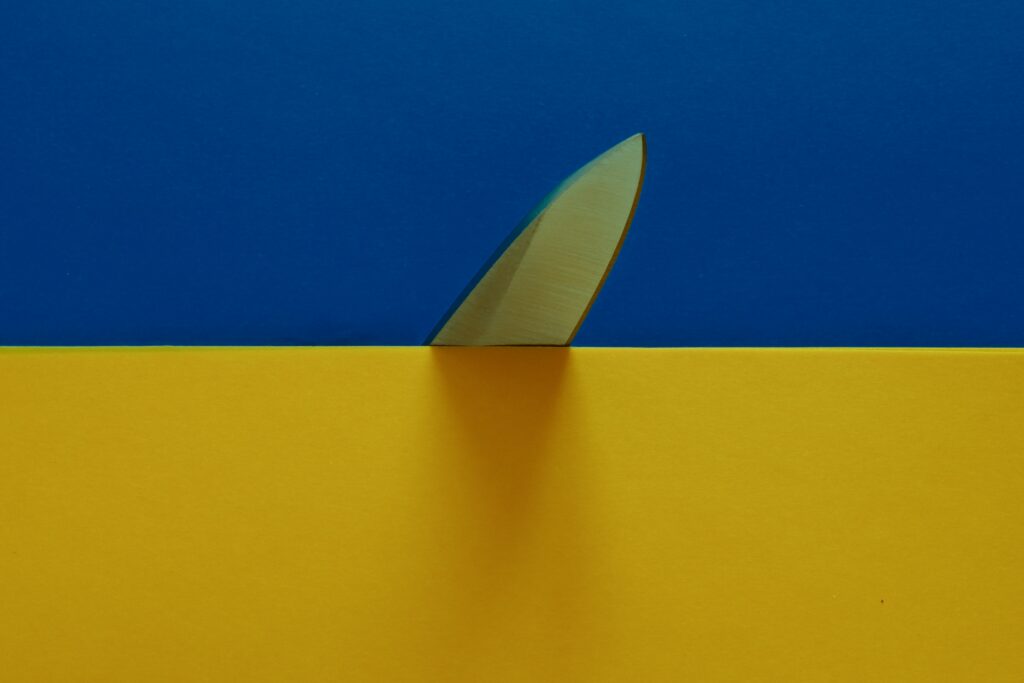Nächste Woche ist Christi Himmelfahrt. Ich bin weiter als sonst mit meiner Vorbereitung, weil wir gestern schon alles für die Evangelische Morgenfeier am 26. Mai (10:30 auf Bayern 1) aufgenommen haben. Ich habe ganz bewusst den Text aus der Perikopenordnung genommen, weil ich den Eindruck habe, der ist aktueller denn je. Hier ist die Extended Version.
Nachts fühlt sich so manches anders an als am Tag. Ich erinnere mich, wie ich als Kind manchmal nachts fiebernd und schweißgebadet aufwachte: Mein dunkles Kinderzimmer schien in diesen Augenblicken immer größer zu werden und ich immer kleiner. In meinen Ohren klang ein Brummen und Dröhnen, das lauter wurde und dann wieder nachließ. Irgendwann schlief ich wieder ein, und wenn ich am Morgen aufwachte, war es hell, das Fieber hatte nachgelassen und ich war wieder normal groß. Aber der nächtliche Schatten war nicht sofort wieder weg. So wie auch heute auf diesen Frühlingstagen für viele Menschen ein Schatten liegt.
Nachts, wenn alles still ist und die Geschäftigkeit des Alltags uns nicht ablenkt, sehen und empfinden wir anders als am Tag. Mitten in der Nacht wirft der jüdische Weise Daniel einen Blick auf die Welt. Albtraumhafte Szenen erscheinen vor seinem Auge. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch Daniel gefühlt immer kleiner wurde beim Hinsehen:
Ich sah vier Winde. Die kamen aus den vier Himmelsrichtungen und wühlten das große Meer auf. Aus dem Meer stiegen vier große Tiere herauf, jedes anders als die anderen. Das erste Tier war einem Löwen ähnlich und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm seine Flügel ausgerissen wurden. Es wurde vom Boden aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt. Ihm wurde menschlicher Verstand gegeben. Dann sah ich ein zweites Tier. Dieses Tier ähnelte einem Bären, und es stand an einer Seite aufrecht. In seinem Maul hatte es drei Rippen, sie waren zwischen seinen Zähnen. Man sagte zu ihm: »Steh auf, friss viel Fleisch!« Dann sah ich ein anderes Tier, das einem Panther ähnelte. Auf seinem Rücken hatte es vier Flügel, die aussahen wie die Flügel eines Vogels. Es hatte vier Köpfe, und ihm wurde Macht gegeben. Dann sah ich in der nächtlichen Vision ein viertes Tier. Es war fürchterlich, schrecklich und sehr mächtig. Seine Zähne waren groß und aus Eisen. Es fraß und zermalmte alles, und was übrig blieb, zertrat es mit den Füßen. (Daniel 7,2-7 Basisbibel)
Sturm wühlt das Meer auf, und nacheinander kriechen aus dem Hexenkessel vier Monster ans Ufer. Schaurige Mutanten sind sie, aus Raubtierteilen zusammengeschustert. Gier, Gewalt und Verwüstung geht von ihnen aus. Und das letzte ist das Schlimmste.
Aber ich stolpere schon vorher beim Lesen: Der Bär hat nämlich ungeheuren Appetit auf Fleisch und wird darin noch kräftig bestärkt. Gab es damals schon eine Ahnung davon, was unser exzessiver Fleischkonsum an Verwüstung anrichten würde – von der Rodung des Regenwalds und der Gewalt gegen indigene Völker über den Methan-Ausstoß der Rinder, die Nitratbelastung der Gewässer, die Qualen der Massentierhaltung und die Geschäftspraktiken von Tönnies und Kollegen?
Wahrscheinlich bin ich auch nicht der einzige, dem zu dem Bären, spätestens aber zu dem Tier mit den eisernen Zähnen, das alles zermalmt und zertrampelt, die Berichte über die Verwüstungen durch Putins Truppen in der Ukraine einfallen. Als dieser Krieg vor einem Vierteljahr begann, hörte ich von vielen Seiten: „Das ist ein Albtraum! Kann ich bitte wieder aufwachen? Am liebsten in den Neunzigern, nach dem Mauerfall, als die Welt fast von selbst besser zu werden schien und Friede und Demokratie überall auf dem Vormarsch waren…!“

Manchmal kommt es mir so vor, als käme gerade ein Monster nach dem anderen um die Ecke: Erst sorgt die Finanzkrise weltweit für Armut und leere Sozialkassen, dann bringt die Demokratiekrise vielerorts rechte Autokraten an die Macht. Im mächtigsten Land der Welt führt das zum Sturm aufs Kapitol. Derweil fegt eine Pandemie über den Globus, die viel Not verursacht und den Zusammenhalt weiter schwächt. Und just in dem Moment, als das Schlimmste ausgestanden scheint und wir uns endlich um die Klimakrise kümmern wollten (die sich immer weiter verschärft!), bricht der nächste größenwahnsinnige Despot einen sinnlosen Krieg vom Zaun. Mit unabsehbaren Folgen für die ganze Welt. Aufwachen in einer heilen Vergangenheit? Träum’ weiter.
Die Welt steht in Flammen, singt Sarah McLachlan, und es geht über meine Kräfte. Herzen sind erschöpft in diesen düsteren Zeiten. Das Licht ist erloschen über Lebenden und Toten, aber ich versuche, mich zusammenzureißen.
Das kleine Horn mit der großen Klappe
Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus ist Daniels monströser Albtraum kein Traum mehr, sondern knallharte Realität. Nachdem die Heere der Babylonier, Meder, Perser und Alexanders des Großen Israel überrollt hatten, entweiht der syrische König Antiochus IV den jüdischen Tempel. In Daniels Traumwelt hört sich das so an:
Ich betrachtete die Hörner. Plötzlich wuchs zwischen ihnen ein anderes, kleines Horn hervor. Da wurden drei von den ersten Hörnern ausgerissen. Auf dem Horn waren Augen, die den Augen eines Menschen ähnelten. Es hatte einen Mund, der großspurig redete. (Daniel 7,8)
Was da gerade vor aller Augen in Jerusalem Wirklichkeit wird, lässt sich nur noch mit grotesken Bildern beschreiben. Das Staatsoberhaupt einer Mittelmacht hält sich für Gott und ist doch nur der Pickel auf dem Kopf des alten Drachen. Aus dieser luftigen Höhe heraus schwingt er sich zu großen Reden auf. Fake News, Lügen, Drohungen, Hassreden, Propaganda. Maßlose Selbstüberschätzung.
Die Bibel beschreibt all das in diesen grellen Bildern, weil die Wirklichkeit so grotesk ist. Es ist grotesk, dass wir so viel über das höllische Ausmaß der Klimakrise wissen, aber den Hintern nicht hochkriegen. Mich hat das umgetrieben, wie erschreckend treffend der Film „Don’t Look Up“ dieses kollektive Versagen aufs Korn nimmt: Eine beißende Satire über Forscher, die einen Asteroiden entdecken, der auf die Erde zurast. Nach einigem Hin und Her werden sie ins Fernsehen eingeladen, um ihre Entdeckung zu erläutern. Aber statt ernsthaft über die zu erwartenden Folgen dieser Kollision zu reden, bekommen sie zu hören: „Keep it light, fun!“ – „Sagen Sie es leicht und lustig!“ Und als eine von beiden vor laufender Kamera traurig und emotional reagiert, weil niemand im Studio die Gefahr erst nimmt, wird sie als hysterische Spinnerin abgestempelt.
Die Welt brennt, und ich pack’s nicht mehr. Lustig und leicht war gestern. Nicht darüber reden zu können, wie es mir damit geht, wenn der Albtraum Wirklichkeit wird, ohne verhöhnt oder beschimpft zu werden, macht alles noch schlimmer. Hier im Buch Daniel (und in anderen apokalyptischen Texten der Bibel) finde ich die befreiende Erlaubnis: Blick den Monstern ins Auge, die über unsere Welt herfallen. Blick deiner Angst, deiner Wut, deiner Verzweiflung ins Auge. Für wie viele ist das Leben ein täglicher Albtraum. Durch Wegschauen oder Abwiegeln wird nichts besser. Das haben die letzten Monate und Jahre eindrücklich gezeigt.
Aber woher soll dann Hoffnung kommen in düsteren Zeiten?
Elons Himmelfahrt
Apropos „Großspurig reden“: Auch die Sonnenkönige des 21. Jahrhunderts, die Superreichen und HighTech-Gurus lassen sich gern als Hoffnungsträger feiern. Allen voran Tesla-Gründer Elon Musk, der sich mit Twitter gerade sein privates Sprachrohr kauft. Dann kann er weiter ungehindert Börsenkurse abstürzen lassen und andere durch Gehässigkeiten einschüchtern. Mit seiner Riesenrakete Starship X will Musk nun den Mars besiedeln. Nicht weil es da so schön wäre – er hat es eilig, von hier wegzukommen. Die Erde ist für ihn ein sinkendes Schiff. Im Februar sagte er:
Wir müssen die Gelegenheit ergreifen, und zwar so schnell wie möglich. Um ehrlich zu sein, Zivilisation fühlt sich gerade ziemlich zerbrechlich an.
„Elons Himmelfahrt“ ist freilich nur den Wenigen vorbehalten, die über das entsprechende Kleingeld oder Beziehungen verfügen. Alle anderen bleiben zurück auf der ausgeplünderten Erde. In Sachen Hoffnung ist dieser Kaiser doch ziemlich nackt.
Mit dem Schlenker ins Satirische, zum kleinen Horn mit der großen Klappe, bahnt sich im Nachtgesicht des Daniel die Wende an. Dieser Galgenhumor schafft Distanz zu dem, was mich bedroht. Und schräge Verfremdungen der Wirklichkeit haben seit je her Hochkonjunktur, wenn Whistleblower und Mahner mundtot gemacht werden.
Als ob
Der russische Autor Vladimir Sorokin hat so eine Szene für unsere Zeit erfunden. In seiner Erzählung „lila Schwäne“ versammelt sich die russische Elite vor der Höhle eines alten Einsiedlers. Der verschrobene Vater Pankrati ist ihre letzte Hoffnung. Denn über Nacht haben sich alle russischen Atomsprengköpfe in Zuckerhüte verwandelt. Einer der Gesandten, Alex, erklärt das Problem:
„Ihr wisst, wo wir alle leben in welchem Land, welchem Staat. Hier ist alles als ob. Ruhe – als ob, Freiheit – als ob, Gesetze – als ob, Ordnung – als ob, … Kirche – als ob, Kindergarten – als ob, Schule – als ob, Parlament – als ob, Gerichte – als ob … Rente – als ob, Käse – als ob, Frieden – als ob, Krieg – als ob. … Echt ist bei uns nur dieser Sprengkopf. Nur dieses Uran, das Lithiumdeuterit. Das funktioniert. Wenn auch das noch zum Als-ob wird, dann ist gar nichts mehr da. Nur noch eine große Leere.“ (V. Sorokin, Die rote Pyramide, S. 130)
Sorokin hat die „Lila Schwäne“ vor dem Überfall auf die Ukraine geschrieben. Aber sein „als-ob“ trifft den Nagel auf den Kopf: Wir haben Wladimir Putin behandelt, als ob er ein verlässlicher Partner mit etwas seltsamen Ansichten wäre. Er ist es nicht. Wir haben so getan, als ob seine Kriegsverbrechen und seine Morde in Syrien, Luhansk, Berlin und London uns egal sein könnten. Sie waren nicht egal. Politiker, Generäle und Stammtisch-Strategen behandelten die Ukraine und ihre Regierung, als ob sie hoffnungslos unterlegen wäre und dem russischen Ansturm nicht mehr als ein paar Tage standhalten könnte. Sie ist es nicht.
Die Monster gebärden sich, als ob die Welt ihre Beute wäre. Sie ist es nicht. Der König redet, als ob er Gottes Stellvertreter auf Erden wäre. Er ist es nicht. Und Daniels Traum ist noch nicht zu Ende.
Die Zeitenwende
Szenenwechsel. Die Bühne wird umgebaut, vom Schlachtfeld zum Gerichtssaal. Der Vorsitzende lässt die Akten kommen. Die Gräueltaten der Angeklagten sind darin lückenlos dokumentiert. Das Urteil fällt – keine große Überraschung – vernichtend aus.
Ich sah, dass Throne aufgestellt wurden und der Hochbetagte sich setzte. Seine Kleidung war weiß wie Schnee, und sein Kopfhaar war wie reine Wolle. Sein Thron bestand aus lodernden Flammen, und dessen Räder waren aus Feuer. Ein Strom aus Feuer floss von ihm weg. Tausendmal Tausend dienten ihm, eine unzählbare Menge stand vor ihm. Es wurde Gericht gehalten, und Bücher wurden geöffnet. Ich sah hin, weil das Horn so großspurig redete. Da sah ich, dass das Tier getötet wurde. Sein Körper wurde vernichtet und dem brennenden Feuer übergeben. Auch den übrigen Tieren wurde ihre Macht genommen. Denn die Länge ihres Lebens war auf die Stunde genau festgesetzt. (Daniel 7,9-12)
Israels Gott erscheint auf der Bühne. Hat J.R.R. Tolkien sich hier seinen Gandalf abgeschaut? Von Altersschwäche jedenfalls keine Spur: Grenzenlose Energie geht von diesem kosmischen Kraftzentrum aus. Als flösse Lava die Abhänge eines Vulkans herab. Alles, was sich dem glühenden Strom in den Weg stellt, wird von dieser Naturgewalt weggerissen und geht unter.
Das ist das Schicksal aller Gewaltherrscher. Ihre Macht ist endlich, auch wenn sie so tun, als ob sie Götter wären. Ihre Zeit ist begrenzt. Die Saat ihres Zusammenbruchs und Untergangs ist schon ausgestreut. Die bitteren Früchte werden früher oder später reifen. Und sie werden sich daran verschlucken. Es mag länger dauern oder kürzer, aber irgendwann ist Schluss.
Kurz nach Kriegsausbruch sagte der ukrainische Botschafter bei den Vereinten Nationen im UN-Sicherheitsrat zu seinem russischen Kollegen: „Es gibt kein Fegefeuer für Kriegsverbrecher. Sie kommen direkt in die Hölle.“ Als ich die Meldung damals las, dachte ich zuerst: Der nimmt den Mund ganz schön voll. Doch als dann die Berichte aus Butscha die Runde machten, fand ich den Gedanken zunehmend tröstlich, dass da jemand ist, der alles Leid sieht, der Grausamkeiten nicht verharmlost, der alles ans Licht bringt und alle Täter zur Rechenschaft zieht. Wer sich also vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag nicht verantworten muss, ist noch lange nicht aus dem Schneider. „Kein Fegefeuer“, das bedeutet, kein Nachverhandeln ist mehr möglich, kein Deal mit dem Staatsanwalt, keine mildernden Umstände.
Wir Protestanten tun uns mit dem Gedanken an ein göttliches Weltgericht ein bisschen schwer. In unserer Genen steckt der Widerspruch gegen jede Form von Kirche, die Menschen einen unbarmherzigen, furchteinflößenden Gott vor Augen malt. Und ihnen wegen Nichtigkeiten mit Höllenqualen droht, um sie gefügig zu machen.
Am Ende kam ein Gott heraus, der in seiner Harmlosigkeit wunderbar in unsere bürgerliche Kirche passt: Eine Art milder, fürsorglicher Onkel. So lange es halbwegs anständig zugeht, lässt er die Dinge laufen. Wenn es Streit gibt und laut wird, mahnt er alle Beteiligten zur Ruhe. In die Politik mischt er sich selten ein, weil es da ständig Streit gibt. Und weil es da um Geld geht – für das er sich auch nicht recht interessiert, so lange die Reichen gelegentlich spenden für Kinder in Afrika. Wenn aber wirklich böse und schreckliche Dinge geschehen, steht dieser liebe Gott genauso erschüttert und überfordert da wie wir.
Je länger ich dagegen in Daniels Traum lese, desto mehr habe ich den Eindruck: Gott ist wie eine Menschenrechtsanwältin, die mit geballter Faust in der Tasche ihren Schützlingen zuhört. Die sich kaum Schlaf gönnt und zu viel Kaffee trinkt, weil sie unermüdlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit dokumentiert, Täter und Auftraggeber identifiziert, Vertuschungen entlarvt.
Macht und Menschlichkeit
In der nächtlichen Vision sah ich einen, der mit den Wolken des Himmels kam. Er sah aus wie ein Menschensohn. Er kam bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Macht, Ehre und Königsherrschaft gegeben. Die Menschen aller Völker, aller Nationen und aller Sprachen dienen ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht, sein Königreich wird nicht zugrunde gehen. (Daniel 7,13-14)
Einer, der aussieht wie ein Mensch, bekommt die Macht übertragen. Menschliche statt unmenschliche, monströse Machtverhältnisse – daran sind die Völker und Reiche der Welt zu oft gescheitert. Nun kümmert sich Gott selbst darum und präsentiert seinen Kandidaten für das Amt des Friedenskönigs.
Mehr als 200 Jahre nach Daniels Monstern erscheint einem verfolgten Christen auf der Insel Patmos wieder einer, der aussieht, wie ein Menschensohn. Er kommt mit den Wolken, Haare und Gewand sind leuchtend weiß, sein Blick ist voll Feuer und seine Füße glühendes Erz. Der Hochbetagte und der Menschensohn aus Daniels Traum sind nun zu einer Gestalt verschmolzen. Und die sagt:
»Hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber sieh doch: Ich lebe für immer und ewig. Und ich habe die Schlüssel, um das Tor des Todes und des Totenreichs aufzuschließen.« (Offenbarung 1,18)
Christi Himmelfahrt – das bedeutet nicht, dass sich Jesus auf einen anderen Planeten beamt. Gottes Himmel ist nicht Lichtjahre entfernt, sondern so nahe wie die Luft, die mich umgibt. Er sieht und hört mich – aber eben nicht nur mich, sondern alle Menschen, überall. Und nimmt Anteil an allem, was mich freut und was mich quält.
Himmelfahrt, das ist aber auch der wahre Albtraum aller Menschenschinder: Ein zu Tode Gefolterter holt die anderen Gewaltopfer aus den Gefängnissen und den Gräbern. Und die Täter müssen ohnmächtig zusehen. Alle ihre Verbrechen kommen ans Licht, alle ihre Lügen fliegen auf. Gott wird „die verderben, die die Erde verderben.“ (Offb. 11,18), weiß der Seher Johannes. Die Gewalt gegen die Mitgeschöpfe, die von ihnen ausgeht, fällt auf sie zurück. In Gottes Gericht spielt auch Ökologie eine große Rolle.
Himmelfahrt ist ein trotziger Feiertag. Für alle, die unter Gewalt und Vernachlässigung leiden, lautet die Botschaft: Auch wenn es im Augenblick nicht so aussieht – das Böse wird ein Ende haben, und die es tun (oder davon profitiert haben) werden sich verantworten müssen. Jeder einzelne. Wenn du klagst, dich fürchtest oder weinst – Gott hält dich definitiv nicht für hysterisch.
Und für mich und alle, die gerade das Glück haben, in relativer Sicherheit schlafen zu können, heißt es: Steck den Kopf nicht in den Sand. Geh der Traurigkeit und dem Schrecken nicht aus dem Weg. Mut und Hoffnung gedeihen auch mitten unter den Albträumen unserer Zeit.
Das englische Wort Awesome bedeutet unter anderem „furchteinflößend“, „fantastisch“, „eindrucksvoll“, „überwältigend“. Für Rich Mullins (oft kopiert, nie erreicht) beschreibt das alles zusammen, wie wir uns Gott vorstellen können.