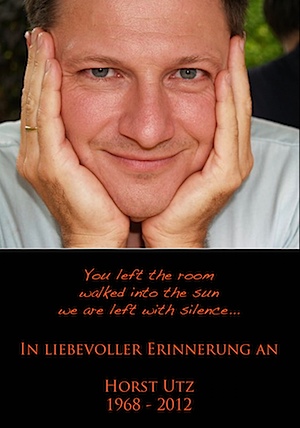(Achtung – erhöhter Schwierigkeitsgrad…)
Iain McGilchrist unterzieht in The Master and His Emissary die Kirchen der Reformation einer radikalen Kritik. In großen Teilen seiner Argumentation stützt er sich auf eine Arbeit von Joseph Koerner, The Reformation of the Image. Körner analysiert die Veränderungen, die durch die Reformation in der sakralen Kunst ausgelöst wurden. McGilchrist interessiert das, weil man daraus Rückschlüsse ziehen kann, ob rechte und linke Hemisphäre des Gehirns in einer gesunden Balance arbeiten oder ob die Linke Gehirnhälfte sich ungut verselbständigt. Ich gebe das im Folgenden erst einmal wieder, wir können dann in Ruhe diskutieren, wie plausibel die Darstellung uns erscheint:
Luthers ursprüngliches Anliegen war es, sagt McGilchrist, wieder zu einem authentischen Glauben zurückzukehren, der nicht auf formalen Autoritäten, sondern lebendiger Erfahrung beruht. Insofern war er ein typischer Mensch der Renaissance. Das innere und das äußere Leben, Sichtbares und Unsichtbares, gehörten für ihn zusammen. Aber seine Nachfolger, zumal Zwingli und Calvin, werteten die materiellen Dinge (mithin das Konkrete und Persönliche) gegenüber dem Geistigen (d.h. dem Allgemeinen) massiv ab – ein klares Indiz für eine „Überfunktion“ der linken Hemisphäre. Im Äußeren verkörpern sich keine geistigen Dinge mehr, es ist ein rein formaler Signifikant, ein abstrakter Hinweis auf eine Sache, die sich woanders befindet (wie ein Straßenschild, das nichts über die Stadt aussagt, auf die es verweist).
Die Reformation ist insofern modern, als sie der erste große Aufbruch zur Gewissheit ist. Schleiermacher hatte schon darauf hingewiesen, dass Reformation wie Aufklärung alles Geheimnisvolle und Wunderbare ächten und die Phantasie von Trugbildern reinigen wollten. Bilder und Metaphern, in denen die rechte Hemisphäre unseres Gehirns kommuniziert, wurden wegen fehlender Eindeutigkeit als störend abgetan. In der Polemik gegen Bilder wurde dann den anderen unterstellt, dass sie die Abbildungen als Götzen verehrten, obwohl doch allen klar war, dass Gott nicht identisch mit einer Ikone oder Statue ist, sondern bestenfalls im Raum zwischen dem Symbol und dem Betrachter gegenwärtig war. Man ließ nur die schroff binäre Alternative gelten, dass eine Statue entweder bloß ein Stück Holz war oder ein Götze.
Luthers Nachfahren hielten sich an das geschriebene Wort (hier kam Gutenbergs technische Revolution, die Schriften in jedes Haus lieferte, verstärkend ins Spiel), das Explizite verdrängte das Implizite und metaphorische. Schön zeigt sich das Dilemma im Abendmahlsstreit. Dort brechen die Reformierten mit der (ihrer Ansicht nach: magischen) Auffassung, dass Gott in den Symbolen Brot und Wein (und, das gehörte ja dazu zugleich im umfassenden Kontext der Messe von glaubender Gemeinde und überlieferter Liturgie) gegenwärtig sein kann, und deuten die den Sinnen zugänglichen Elemente als bloße Zeichen einer von ihnen weit entfernten und prinzipiell unabhängigen Wirklichkeit. Sakramente vermitteln nun Information, sie haben nur eine Bedeutung, aber keine Substanz mehr, denn sie stehen für einen Inhalt, der jenseits aller Form ist und daher potenziell jede Form annehmen kann. In der Tat ist die Ansicht, man könne zwischen Form und Inhalt trennen, eine der fatalsten Folgen der Reformation.
Damit, sagt McGilchrist, nimmt die Reformation „die hermetische Selbstreflexivität des Postmodernismus“ vorweg. Bilder verweisen nur noch auf sich selbst, sie sind nicht mehr transparent auf eine tiefere Wirklichkeit, etwas anderes: aus dem Protest gegen leere Strukturen ist selbst eine Struktur geworden, die keinen Inhalt mehr braucht. Entsprechend kommen Bilderrahmen mit dicken Textunterschriften in Mode, um das Gezeigte zu objektivieren. Das Geschriebene Wort erhält dinglichen Status, und damit es seine Wirkung nicht verfehlt, wird es endlos wiederholt. Weil das einen mechanischen Charakter annimmt, wird das Wort schließlich selbst zu einer Art Talisman mit magischer Qualität, kurz: zum Götzen. Das Motiv hier ist die Kontrolle:
Die Machthungrigen sind immer darauf aus, intuitives Verständnis durch explizites zu ersetzen. […] daher haben die Calvinisten eine Ausradierung der Vergangenheit unternommen, die die Vernichtung all dessen einschließt, was die Erinnerung daran nährt, wie die Dinge einst waren – eine Art Rote Revolution, ‚die nichts in den Kirchen lässt, an was man sich noch erinnern könnte.‘
Im Blick auf das Sakrament bedeutet dieser Eindeutigkeitswahn der protestantischen Orthodoxie, dass eine Art leibfeindlicher Manichäismus entsteht. Das Element verkörpert nicht mehr den Leib Christi es weist nur auf ihn hin, denn das Fleisch ist unnütz, nur der Geist zählt. Jener ist vergänglich, das Wort hingegen zeitlos und damit gottähnlich. Daher ist die einzig wahre Kirche auch die unsichtbare Kirche, die an keinem konkreten Ort mehr zu finden ist. Im Prinzip ist nun alles heilig, praktisch aber ist nichts mehr wirklich heilig, denn die Worte entfernen sich so weit von aller erfahrbaren Wirklichkeit, dass sie nichts mehr auslösen.
Die rechte Hemisphäre kann sowohl das Ganze sehen (und nicht nur ein Aggregat von Einzelteilen), sie sieht aber auch das konkrete und Einzigartige, während die linke nur das Allgemeine und Generelle erkennt. In der Schöpfungsgeschichte scheidet Gott die Dinge, sie werden individuell und besonders. Der Hang zum (All-)Gemeinen hingegen macht aus einem lebendigen, veränderlichen und beweglichen Gegenüber ein totes, starres Objekt.
Und so befördert, sagt McGilchrist unter Verweis auf Max Weber, der Protestantismus nicht nur den Kapitalismus, besonders durch seine starke Betonung der Handlungsfähigkeit Einzelner, sondern auch die Bürokratie der Obrigkeit, etwa bei den Lutheranern in Deutschland. Wo vor allem die Handlungsfähigkeit des Einzelnen im Blick ist, da geht es um Selbstschutz, Selbstbehauptung und Selbsterweiterung und somit auch Entfremdung, Isolation und Einsamkeit, bei Protestanten und Kapitalisten. Daher ist der Kapitalismus auch traditionsfeindlich, denn Traditionen verkörpern die Weisheit früherer Generationen, die sich zwar organisch wandeln, aber abstrakten Neuentwürfen erst einmal im Wege stehen.
Nachdem die Reformatoren sich der Macht von Kirchenfürsten und deren Monopolisierung des Heiligen entzogen hatten, trugen sie diese Macht dem Staat an und verliehen den staatlichen Institutionen eine quasireligiöse Aura. Die obrigkeitliche Kontrollmentalität verrät beispielsweise der Kirchenbau: die erhöhte Position der Kanzeln, gelegentlich (als Erlanger kennt man das bestens von den sogenannten „Markrafenaltären“) sogar in den Altar integriert, um von dort die moralischen Ordnungen an die Untertanen im Kirchengestühl zu vermitteln. Und in den reformierten Kirchen herrschte eine große Vorliebe für streng symmetrische Bankreihen – diese starre Ordnung ist vermittelt ein völlig anderes Grundgefühl als das Stehen in einer unordentlichen, nie völlig still stehenden Menge, das in den Kirchenräumen vor der Reformation normal war.
Der eigene „demokratische“ Anspruch wird durch die Sitzordnung schon wieder konterkariert, denn schnell wurde die Vergabe der besten Sitzplätze (und damit die Demonstration des eigenen sozialen Status) zum einträglichen Geschäft. (N.B.: Die Wikipedia verrät zum Thema Kirchenstühle und soziale Ordnung zum Beispiel dies: „In den streng protestantischen Gebieten Württembergs war es teilweise bis zur Wende zum 20. Jahrhundert üblich, Frauen, die uneheliche Kinder erwarteten, in der Kirche auf einem separaten Platz, dem sogenannten Hurenstuhl, auszustellen.“)
Freilich, sagt McGilchrist, war der Protestantismus immer sehr vielschichtig. Gemeinsam ist den verschiedenen Richtungen jedoch
- die ausgeprägte Präferenz für Klarheit und Gewissheit statt Offenheit und Ambivalenz
- die Präferenz für das Einzelne, Bestimmte, Statische und Systematische (statt für das Fließende, Vielfältige, Bewegliche und Kontingente)
- die Bevorzugung des Wortes gegenüber dem Bild, des strikten Wortsinns gegenüber der Metapher
- die Neigung zur Abstraktion und Abwertung des Natürlichen (bzw. besonders bei den Puritanern des sinnlich-Ästhetischen)
- der stete Verweis auf verschriftlichte Sprache und ständige Querverweise zwischen Schriften, statt dass implizit zwischen den Worten noch etwas anderes, Unaussprechliches wahrgenommen und als gegenwärtig erfahren wird (Abraham Heschel würde vielleicht sagen: Der Sinn dafür, dass die Welt eine große Anspielung auf das Geheimnis Gottes ist, ging verloren).
- das grundsätzliche Misstrauen gegen die Weisheit von Traditionen und der rationalistische Angriff auf alles „Heilige“ (Räume, Zeiten, Menschen, Rituale etc.)
Das Tor zur Aufklärung war damit also längst weit aufgestoßen, die Saat der Selbstsäkularisierung ausgestreut, und McGilchrists bitteres Fazit zu diesem Abschnitt lautet:
In essence the cardinal tenet of Christianity – the Word is made Flesh – becomes reversed, and the Flesh is made Word.
Ein paar Anmerkungen meinerseits:
Wenn McGilchrist, Weber und Körner Recht haben, dann wäre auch sofort nachvollziehbar, warum sich schon bald auch unter Protestanten wieder mystische Strömungen bildeten, etwa Johann Arndt (1555-1621), der sich, wie später auch Spener (sicher kein Zufall!) auf Luthers eigentliche reformatorische Intentionen berief.
Äußerst spannend finde ich, dass für McGilchrist gerade neopuritanische Bewegungen in ihrer Fixierung auf das Absolute, auf Gewissheit und Eindeutigkeit, das Explizite und Buchstäbliche und dem tiefen Misstrauen gegen alles Natürliche enge geistige Verwandte des verhassten Postmodernismus sind, der in bestimmten Spielarten zur völligen Virtualisierung neigt und der Auflösung der Beziehung von Signifikant und Signifikat.