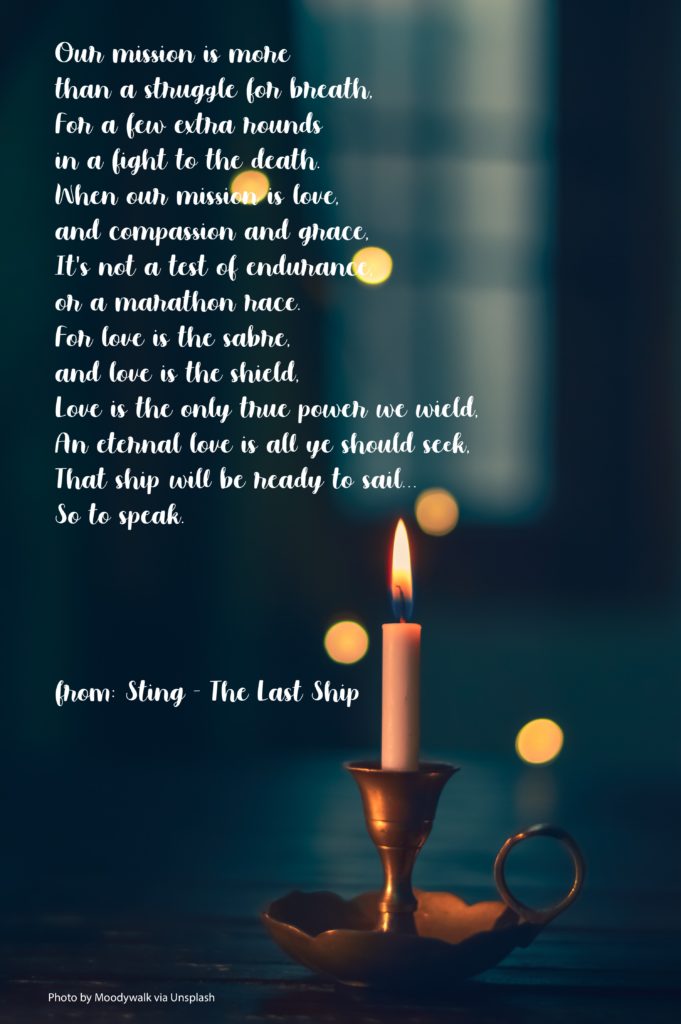Von Lederstrumpf bis Lucky Luke: Der Wilde Westen hat die Fantasie vieler kleiner und großer Jungs beschäftigt. High noon und das Lied vom Tod, Büffelherden und Bürgerwehren, Lagerfeuer und Lynchjustiz, reichlich Feuerwasser und am Ende immer ein einsamer Cowboy, der in den Sonnenuntergang reitet.
Man kann sich über die Klischees, die in dieser Männerwelt drinstecken, amüsieren. Oder kritisieren, wie historisch ungenau und vorurteilsbeladen da erzählt wird – etwa wenn die amerikanische Urbevölkerung abwechselnd als edle Wilde oder zähnefletschende Barbaren auftaucht. Aber vielleicht hatte das alles ja schon immer damit zu tun, dass wir Europäer uns selbst in diesen Geschichten wiederfinden wollten. Ein literarischer Spiegel unserer Ideale und Abgründe, Abenteuerlust und Albträume.
Kürzlich habe ich mich wieder an einen Text von Brennan Manning erinnert. Er greift die Gegenüberstellung von Siedlern und Pionieren aus einem älteren Buch, Western Theology von Wes Seliger, auf. Und weil bekanntlich das Sein das Bewusstsein bestimmt, sehen diese beiden Communities Gott und die Welt ziemlich unterschiedlich.
Western ist freilich nicht jedermanns Sache. Wer damit Mühe hat, kann beim Weiterlesen genauso gut an Star Trek mit seinen Kapitänen Kirk und Picard und ihrer Crew denken. Die Zivilisationsgrenze wird da vom amerikanischen Kontinent in den Weltraum verlegt: „The final frontier“, sagt der Vorspann. Und dann folgt das berühmte „to boldly go where no man has gone before“.
Ich bin in den letzten Jahren aus einem eher pionierhaften Kontext in eine mehrheitlich (aber keineswegs ausschließlich) von Siedlern geprägte Kultur umgezogen. Fun fact am Rande: Mitten durch die Kirchengemeinde, in der ich jetzt arbeite, zieht sich die Siedlerstraße. Auf der einen Seite die Siedlerhäuschen, auf der anderen der Wald: Eine stetige Erinnerung an diese Western-Typologie.
Meine Eltern, eher stetige Wesen, haben einmal gefragt, wie es eigentlich kommt, dass ich immer diesen Drang über das Gewohnte hinaus habe und mich mehr für das Morgen interessiere als für das Gestern. Kurz darauf stieß ich auf das Familienwappen meines im Krieg verschollenen Großvaters. Dort steht als Wahlspruch: „Immer vorwärts“. Wir sind uns zwar nie begegnet, aber ausgehend von dem Wenigen, was ich über ihn weiß, würde ich sagen: Das passt.
Und damit zurück in den Wilden Westen.
Die Typologie
Siedler sehen das Leben als einen Besitz an, der sorgsam gehütet werden muss. Pioniere sehen es an als ein abenteuerliches, wundersames Geschenk.
In der Welt der Siedler dreht sich alles um Sicherheit. Das Weideland wird eingezäunt, die Haustüre verriegelt, das Geld auf die Bank gebracht. Kirche ist für sie wie das Rathaus der Westernstadt. Mit seinen dicken Mauern und kleinen Fenstern gleicht es einer Festung. Drinnen werden Akten geführt, Steuergelder aufbewahrt und Bösewichten der Prozess gemacht.
Gott ist in dieser Welt der Bürgermeister. Eine ehrwürdige Erscheinung in seriösem Schwarz. Er residiert gut abgeschirmt ganz oben im Rathaus. Von dort hat er die ganze Stadt im Blick. Er zeigt sich selten. Aber die Ordnung, die in der Stadt herrscht, beweist ja, dass es ihn gibt. Die Siedler fürchten ihn, andererseits halten sich deshalb aber auch alle an die Regeln. Wenn mal wieder ein Zug von Pionieren näherkommt, schickt er den Sheriff hin, um keine Zweifel aufkommen zu lassen, wer hier den Ton angibt.
Bei den Pionieren ist alles in Bewegung. Ihre Kirche ist der Planwagen, immer unterwegs in die Zukunft. Das ganze Leben spielt sich dort ab: Sie essen, schlafen, lieben, kämpfen und sterben dort. Der Planwagen knarzt und holpert, ist eng und unbequem. Aber den Siedlern ist das egal. Denn Gott ist der Zugführer, der Trail Boss. Er ist ungehobelt und voller Leben, kaut Tabak und trinkt den Whisky unverdünnt. Immer wieder zieht er die Karren mit aus dem Dreck. Und wenn jemand schlapp machen will, nimmt er ihn sich zur Brust.

Für die Pioniere ist Jesus der Scout. Er reitet voraus und setzt sich damit noch größeren Gefahren aus als die anderen. Er weiß wie kein anderer, was der Trail Boss vorhat. An ihm können alle ablesen, was es bedeutet, ein Pionier zu sein. Der Heilige Geist ist für sie der Büffeljäger. Ein rauer, unberechenbarer Geselle mit einem höllisch lauten Schießeisen. Er versorgt die Pioniere auf ihrem Zug mit lebenswichtiger Nahrung. Aber man weiß nie genau, was er als nächstes anstellt.
Am Sonntagmorgen zieht es den Büffeljäger in die Stadt. Da treffen sich nämlich die Siedler im Rathaus zum Kaffeekränzchen. Er schleicht bis unters Fenster und lauscht. Plötzlich ballert er in die Luft. Fenster klirren, Hunde bellen und die Leute drinnen verschlucken sich an der Torte.
Für die Siedler ist Jesus der Sheriff. Er reitet mit seinem weißen Hut durch die Stadt, verjagt das Gesindel und buchtet die Störenfriede ein. Und der Heilige Geist ist das Mädchen im Saloon. Bei ihr suchen die Siedler Trost, wenn sie einsam sind oder vor etwas Angst haben. Sie krault die Siedler unterm Kinn, damit sie sich besser fühlen. Und wenn im Saloon die Fetzen fliegen, kreischt sie so laut, dass der Sheriff kommt. Sünde ist für die Siedler, wenn jemand sich nicht an die Ordnung hält. Für die Pioniere ist es Sünde, wenn jemand aufgibt und umkehren will.
Wild West Reloaded
Unsere Welt hat sich in den letzten drei Jahrzehnten massiv Richtung Wildwest 2.0 verändert. Vieles, was Orientierung, Halt und Sicherheit gab, ist weggebrochen. In der SZ schrieb Sebastian Gierke kürzlich: „Der Marktliberalismus will vor allem das selbstbestimmte, kreative, atomisierte Individuum. Narzissten, Egomanen und Selbstausbeuter.“ Die Politik der Deregulierung hat den fürsorglichen Sozialstaat der Nachkriegszeit entkernt. Unternehmensgewinne wurden privatisiert, die Aktienmärkte hingegen mit Steuergeldern gerettet. Mittlerweile beschert uns der globale Plünderungskapitalismus eine Krise nach der anderen – wirtschaftlich, ökologisch und sozial. Und kriminelle Postkutschenräuber wie die Chefs von Wirecard. Oder einen US-Präsidenten, den der Philosoph Cornel West als Gangster bezeichnet.
Seit 2008 bröckelt daher weltweit das Vertrauen, dass die liberale Demokratie ihren Bürgern Wohlstand und Chancengleichheit garantiert. Populisten versprechen uns auf Facebook und Twitter die Sicherheit und Stabilität von früher – wenn wir nur einfach alle wieder Diesel fahren und mit deutscher Kohle heizen, die Grenzen mit Stacheldraht dichtmachen und Solidarität strikt auf gesunde und fleißige Biodeutsche beschränken.
Die Zivilisationsgrenze des 21. Jahrhunderts verläuft im Internet. Wie damals im Wilden Westen hat die Digitalisierung uns heute Situationen beschert, für die es noch keine guten Regeln und Ordnungen gibt oder in denen das Recht nicht durchgesetzt werden kann. Und nun auch noch die Pandemie, die vieles verschärft. Australiens Milliardäre sind im letzten Jahr um 50% reicher geworden, meldet der Guardian. Auf der anderen Seite rutschen gerade 207 Millionen Menschen in extreme Armut ab. Da kann einem wirklich Angst und Bange werden. Die Sonne geht unter, wir sind allesamt einsame Cowboys – und nichts daran ist romantisch.
Verunsicherte Kirchen
Hier und da sind Kirchen der Versuchung erlegen, sich im Strudel der Veränderung als Inseln der Stabilität anzubieten. Das ist verständlich, weil wir in den Großkirchen eine sehr seßhafte und solide Gestalt von Kirche entwickelt haben. Seit Jahrzehnten, oft seit Jahrhunderten stehen die Kirchen mitten im Dorf. Fest gegründet im bürgerlichen und bäuerlichen Milieu, mit verbeamtetem Personal zur Pflege traditionellen Brauchtums. Konrad Adenauers berühmtes Motto „Keine Experimente“ steht auch 60 Jahre später noch hoch im Kurs. Wenn in dieser kirchlichen Binnenkultur ein Vorschlag als „abenteuerlich“ bezeichnet wird, kann man sicher sein, dass das kein Kompliment war.
Für immer mehr Menschen erweist sich das als fremde, unzugängliche Blase, in der die Unsicherheit ihres Alltags vielleicht bedauert wird, aber Antworten und Lösungen (eben weil sie Experimente erfordern) Mangelware sind. Das hat zur oft thematisierten Krise der Kirchen hierzulande beigetragen, und nun zeigt sich, dass sich die alte Normalität (und von Corona reden wir hier noch gar nicht…) nicht mehr lange aufrecht erhalten lässt, weil das Geld und das Personal knapp wird. Wenn wir aber so verunsichert sind, dass wir keine Sicherheit mehr bieten können, was haben wir dann noch – außer ein zaghaft-trotziges „Fürchte dich nicht“?
Der heikle Flirt mit der Ökonomie
Die Diskussion um eine Umgestaltung und Reform der Kirchen ist in vollem Gange, aber sie verläuft nicht immer glücklich oder konstruktiv. Manche Akteure haben Sprache und Konzepte aus der New Economy übernommen. Schlagwörter wie „StartUp“, „Entrepreneur“ oder „Flexibilisierung“ erinnern aber nicht nur hartgesottene Traditionalisten an die Ich-AGs der Agenda 2010, an Entsolidarisierung und die Ideologie der „kreativen Zerstörung“. Kurz: All das, was unser gesellschaftliches Schlamassel mit verursacht hat. Ich denke nicht, dass dieser Reflex den Absichten und Vorschlägen der Reformer gerecht wird. Aber ich kann verstehen, wie manche auf die Idee kommen, hier finde ein Angriff statt und sie müssten die Kirche vor der totalen Ökonomisierung retten. Die hat schließlich schon im Sozialsystem und im Bildungswesen massive Schäden verursacht. Droht also eine Zerschlagung der Gemeinden und kommt am Ende eine Art marktkonforme Kirche heraus – flexibel und verflüssigt bis zur baldigen Unkenntlichkeit – oder ist das nur falscher Alarm aus der Siedlerecke?
Wir könnten uns freilich auch an den Megachurches amerikanischen (oder australischen) Zuschnitts orientieren. Sie glänzen mit unverschämt gut aussehenden Typen in Designerklamotten, professionellem Corporate Design und positiv-sentimentaler Wohlfühlmusik. In Sachen Marketing macht ihnen jedenfalls keiner etwas vor: Sie liefern die perfekte Synthese aus Bibel und Konsumgesellschaft. Zwischen den Zeilen wird kommuniziert: Schließ dich uns an, dann bist du bald auch so attraktiv wie wir. Wenn ich ihnen eine Weile zuhöre, entdecke ich da reichlich Tipps zur spirituellen Selbstoptimierung, aber meistens fehlt mir die ernsthafte Auseinandersetzung mit den politischen und sozialen Ursachen unserer Sorgen, Selbstzweifel, Müdigkeit und Resignation. Auch hier wird mir signalisiert: Gott begegnest du im Vertrauten, Beherrschbaren und Reproduzierbaren – und eher nicht im Unbekannten und Fremden.
Pioniere des wilden Ostens
Die großen, prägenden Gestalten der Bibel haben das ganz anders erlebt: Der seßhafte Abraham verlässt seine Heimat auf Geheiß eines unsichtbaren Gottes, der ebenfalls keinen festen Wohnsitz hat. Mose führt die Israeliten aus Ägypten in das verheißene Land. Er selbst sieht es nur noch aus der Ferne. Aber Gott zieht die ganze Zeit voraus, in Wolke und Feuer gehüllt. Jesus und seine Jünger folgen diesem Muster. Ständig sind sie unterwegs. Am Ende stirbt auch Jesus draußen, vor den Toren Jerusalems. Nach Pfingsten wandern die ersten Christen unermüdlich durch das römische Reich. Die Verfasser*in des Hebräerbriefes blickt zurück auf diese Pioniere:
Glaube aber ist: Feststehen in dem, was man erhofft,
Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht.
Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf,
wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte;
und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde.Aufgrund des Glaubens hielt er sich als Fremder
Hebr 11,1ff
im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf
und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten;
denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern,
die Gott selbst geplant und gebaut hat.
Die Mütter und Väter des Glaubens, ohne die es kein Evangelium und keine Kirche gäbe, waren allesamt Menschen, die ihr Leben lang auf dem Weg durch den wilden Osten waren. Ihre Zelte waren die Vorläufer der Planwagen. Und sie lebten als „Gäste und Fremdlinge“, sagt die Bibel. Oder um ein anderes Wort zu verwenden: Sie waren Pilger.
Und so gilt auch für uns:
Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.
Hebr 13,14
Was die Pioniere des wilden Ostens und Westens verbindet (und zugleich von heutigen Rotstift-Reformern, Monaden und Selbstvermarktern unterscheidet), das ist die Einsicht, wie sehr sie auf einander angewiesen sind. Dasselbe gilt für die Pilger: Sie sind ja keine Einsiedler. Die vielen Begegnungen auf dem Weg sind mindestens so heilsam und bereichernd wie die Stille und die Konfrontation mit dem inneren Schweinehund. Der Weg, der uns aufgegeben ist, ist so weit und so entbehrungsreich, dass er nur gemeinsam gemeistert werden kann. Und wenn wir die großen Herausforderungen anschauen, vor denen unsere Gesellschaft steht – die ungelöste Klimakrise, Konflikte, die in Hass und Gewalt umschlagen, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich – dann wird das mit Siedlermethoden (alles bleibt wie es war) nicht zu lösen sein.
Zeit zur Erkundung
Religionssoziologen haben beobachtet, dass über die letzten Jahrzehnte immer mehr Menschen eine „Spiritualität der Seßhaftigkeit“ aufgeben und eine „Spiritualität des Suchens“ vorziehen: Erfahrungen statt Wissen, Vorläufiges statt Fixiertes, ausgehandelte statt vorgegebene Deutungen. Dass wir in den Kirchen das Pilgern neu entdeckt haben, fügt sich gut in dieses Bild. Weil vieles Gewohnte in den Kirchen seit Ausbruch der Corona-Pandemie nicht mehr funktionierte, haben viele Gemeinden munter experimentiert. Plötzlich geht etwas!
Kann es also sein, dass im Lärm der Krisen, der unsere Kirchenfenster klirren lässt, der Schuss des Büffeljägers zu hören ist? Der will den Siedlern ja nicht einfach nur einen Streich spielen. Sondern sie aufwecken und daran erinnern, dass sie selbst (oder ihre Eltern und Großeltern) irgendwann einmal Auswanderer und Pioniere waren.
T.S. Eliot schreibt:
We shall not cease from exploration,
Four Quartets
and the end of all our exploring
will be to arrive where we started
and know the place for the first time.
Das Ankommen, das Erkennen und Erkanntwerden steht uns allen erst bevor. Bis dahin gibt es noch viel zu erkunden. Je nach Tagesform bin ich mal mehr Siedler und mal mehr Pionier. Im Alltag ist das gar kein so klares Entweder-Oder. Ich merke aber, dass es mir besser geht, wenn ich öfter auf den Pionier in mir höre. Und wie ich aufblühe, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die sich in den Umbrüchen dieser Zeit nicht verkriechen, sondern zum Aufbruch bereit sind.
Wenn ich anfange, Gott außerhalb des Bekannten und Gewohnten zu suchen, dann habe ich mit den Menschen um mich herum – ob sie religiös sind oder nicht – diese eine Sache schon einmal gemeinsam: Ich weiß nicht genau, was mich erwartet. Wie ich mit diesem Nichtwissen umgehe, ist für die anderen Bewohner des WildWest 2.0 womöglich interessanter als das, was ich schon weiß.
Ging es nicht genau darum an Weihnachten? In dieser ganzen Ungewissheit ist uns der Sohn Gottes nahe. Geboren zwischen Tür und Angel. Bei den underdogs, im prekären Milieu der Hirten und Tagelöhner. Seine merkwürdigen Gäste aus dem Morgenland standen in Jerusalem unter Spionageverdacht und mussten untertauchen. Die Weihnachtsgeschichte redet die Welt nicht schön. Aber sie weiß von der Herrlichkeit Gottes darin zu erzählen.
Der Pionier in mir
Wenn in jedem von uns ein Pionier schlummert, wie kann er wachgeküsst werden?
Pioniere können Pioniere wachküssen. Sie sind freilich nicht automatisch netter oder unkomplizierter als Siedler. Wenn mir das nächste Mal welche begegnen, kann ich ein eventuell auftretendes Unbehagen zur Kenntnis nehmen. Aber dann kann ich es auch zurückstellen und fragen: Was treibt dich an? Was hast du entdeckt? Wolltest du schon mal aufgeben und warum hast du es nicht getan? Wo ist dir Gott begegnet?
Kann ich Pilger sein, wenn die Welt im Lockdown ist? Ja, natürlich. Ich muss ohnehin auf vieles Gewohnte verzichten: Reisen, Aktivitäten, Fortbildungen oder Feste. Da ist Platz für neue Routinen und spirituelle Suchbewegungen: Stillhalten und Lauschen. Horizontwerweiternde Lektüre. Die liebevolle Aufmerksamkeit, mit der ich meine inneren Widerstände und Fluchttendenzen wahrnehme, ohne ihnen nachzugeben. Und der Zuspruch von Weggefährt*innen – funktioniert auch mobil und digital.
Gilbert K. Chesterton, der Schöpfer des listigen Pater Brown, hat einmal festgestellt:
Ein Abenteuer ist bloß eine recht verstandene Unannehmlichkeit.
Eine Unannehmlichkeit ist bloß ein missverstandenes Abenteuer.
Das neue Jahr wird erst einmal mit allerhand Ungewissheit und Unannehmlichkeiten losgehen. Daran können wir nichts ändern. Aber wir könnten die Einladung annehmen, die pionierhaften Wurzeln unseres Glaubens wieder neu zu entdecken – abseits der gewohnten Pfade.
Also da, wo wir alle gerade herumstolpern.