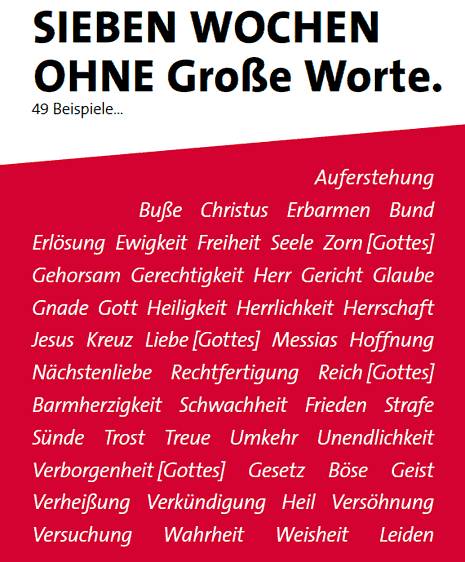ich habe den fröhlichen Klang der Stimmen, die Abenddämmerung nach der großen Hitze, die Kerzen auf unserer Terrasse, den Geruch von Gras, Wein und Pasta noch ganz frisch im Gedächtnis. Spät am Abend seid Ihr von meiner Geburtstagsfeier aufgebrochen, und wie hätte man in der gelösten Stimmung auch nur im Entferntesten auf die Idee kommen können, dass wir uns gerade für immer verabschieden – diesseits der Ewigkeit?
In diesen letzten Wochen habe ich Dich gelöst erlebt, wie Du von der letzten Reise geschwärmt hast und Dich auf den bevorstehenden Urlaub in Rovinj gefreut hast, das für Dich ein paradiesischer Ort war. Diese Leichtigkeit mitzuerleben war angesichts all der schweren und düsteren Zeiten, die Du in den letzten Jahren wiederholt durchleiden musstest, etwas sehr Kostbares. Deine äußere Robustheit und Umtriebigkeit hat diese zerbrechliche Zartheit häufig verdeckt, und manchmal, so scheint mir, bist du selbst darüber erschrocken, wenn sie durchkam.

Aber auch im finstern Tal warst Du Dir nie selbst genug, immer hast Du Dich erkundigt, identifiziert, Anteil genommen, Dich nach Kräften und darüber hinaus zuständig gefühlt und mitgedacht. Das ist auch eine dieser Erinnerungen, die bleibt und um die wir uns in diesen Tagen immer wieder versammeln. Es gibt, um eine Redewendung aus „Der Gott der kleinen Dinge“ zu borgen, ein Udo-förmiges Loch im Universum. Und unsere Seele taumelt hin und her zwischen Tränen, Taubheit oder Trotz, und findet zwischendurch Halt in irgendeiner mechanischen Tätigkeit, zu der wir uns überreden.
Als unser gemeinsamer Freund Horst vorletztes Jahr – auch in den Ferien, auch am Wasser – verunglückte, als jene Lücke im Universum sich jäh vor uns auftat, waren wir beide in so einem benommenen Zustand – und es war gut, dass wir einander hatten. Ich habe die Worte damals ein bisschen eher wiedergefunden als Du, aber jetzt kämpfe ich mächtig darum, und es fällt mir schwerer denn je. Als hätte jemand zähes Schweröl über meine Gedanken ausgegossen. Die Nachricht, dass ein achtloser Freizeitkapitän Dich arglosen Schwimmer tödlich verletzt hat, hätte unfassbarer nicht sein können – und sie fühlte sich doppelt bitter an. Bestimmt muss es doch ein Gesetz geben, das mehrere Schläge in die gleiche Kerbe untersagt! Die Ähnlichkeit hat für uns Hinterbliebene (seltsam, wie ein so hölzerner Begriff die Gefühlslage so treffend abbilden kann…) nicht nur etwas absurd Sinnloses, sondern auch fast etwas Zynisches an sich, weil sie das Einzigartige dieses Verlustes scheinbar relativiert.
Unbegreiflich ist Dein Weggang auch, weil wir alle Deine Beständigkeit und Treue kannten. Wenn Du in den Urlaub aufbrachst, hast Du Dich meist verabschiedet und danach wieder zurückgemeldet. Wen Du einmal in den Kreis Deiner Freunde aufgenommen hattest, der musste sich schon selbst daraus entfernen. Alle anderen Adressaten Deiner Anteilnahme und Fürsorge konnten Deines Wohlwollens gewiss sein – auf Lebenszeit. Die aber haben wir, wie sich zeigt, zu optimistisch eingeschätzt.
In den letzten vierzehn Tagen habe ich mit vielen geredet, die Dich gekannt und geschätzt haben. Es gab kaum ein anderes Thema. In ihren Worten war so viel Sympathie, Dank, Bewunderung und Hochachtung zu spüren. Und es waren immer wieder Erinnerungen dabei, wo wir trotz allem ins Schmunzeln kamen. Dieses „Höher, schneller, weiter“ etwa, das nicht nur in Deiner Leidenschaft für den Sport zu spüren war und allen, die mit Dir in den Bergen gewandert sind, in lebhafter Erinnerung bleibt. Du hast Dinge nie auf-, sondern unermüdlich angeschoben. Das hat es manchmal auch ein wenig anstrengend gemacht für uns, aber Du hast es Dir selbst mehr als jedem anderen zugemutet. Und während wir so redeten, fragte ich mich, ob hinter dieser Eile und dem Elan, mit dem Du Deine Tage so randvoll bepackt hattest, irgendwie schon immer die Ahnung steckte, dass Dir tatsächlich weniger Lebenszeit vergönnt war als vielen anderen.
Am Morgen nach Deinem Tod nahm ich an einer Andacht teil. Sie fand im Garten eines Exerzitienhauses statt und begann mit der Einladung, mich umzusehen und dann einige Minuten an einem Ort zu verbringen, zu dem ich mich hingezogen fühlte. Zwei Meter vor meinen Füßen stand eine Pusteblume, die der Rasenmäher offenbar verfehlt hatte – die einzige weit und breit. Ich blieb regungslos stehen vor diesem Symbol der Verletzlichkeit und Vergänglichkeit. Und während ich noch dort stand und die Blume ansah, kam jemand vorbei und stieß mit dem Schuh dagegen. Silberne Schirmchen flogen mit dem Luftzug davon, der Stiel blieb fast kahl auf der Wiese zurück. Ich sah noch einen Moment hin, dann kamen die Tränen. Die stumme Trauer hatte in diesem Zeichen einen Ort gefunden, an dem sie zur Geltung kommen konnte – nicht nur in mir sondern vor Gott.

Als ich über diese Szene nachdachte, fiel mir noch eine weitere Dimension auf, die auch gestern, bei Deiner Beerdigung, mit Händen zu greifen war: Solche „Schirmchen“ Deines Wesens tauchen an so vielen Stellen auf, manch sind tausende Kilometer weit geflogen. Sie sind gelandet bei Menschen, mit denen Du über lange Zeit, große Entfernungen und so manch harte Zerreissproben den Kontakt gesucht, gehalten und oft auch wieder neu geknüpft hast. Ich habe das Nachmittagsprogramm an diesem Tag geschwänzt, meine Laufschuhe angezogen und bin in den Wald gelaufen. Es schien mir der richtige Ort, um an Dich zu denken. Schirmchen flogen durch meinen Kopf – die vielen Runden, die wir in den letzten Jahren durch die Mönau, den Buckenhofer und Tennenloher Forst gedreht haben, während wir über die Höhen und Tiefen unseres Lebens redeten, oder uns Gedanken über Zustand und Richtung unserer Gemeinde machten. Eingehüllt vom intensiven Geruch des Waldes, den Sonnenstrahlen zwischen den Buchenblättern, dem kühlen Wind auf der Hochfläche war die Einsamkeit ein willkommenes Geschenk. Der Takt der Schritte auf dem Schotterweg machte meine Sprachlosigkeit und Leere erträglich.
Ich habe mich in den letzten beiden Wochen mehrfach gefragt, an welchen Ort ich mich zurückziehen könnte, um mich an Dich zu erinnern, aber es fiel mir kein passender ein. Nicht die Ruhe, sondern die Bewegung fühlt sich „richtig“ an. Ich laufe zwar schon immer auch gern alleine, trotzdem werde ich Dich sehr vermissen. Über all die Jahre und Kilometer ist jeder auch ein Teil vom anderen geworden. Von nun an wird die Lücke, die Du hinterlässt, mich begleiten. Seltsamerweise spüre ich schon jetzt, wie mir auch die Seiten an Dir fehlen, an denen ich mich immer wieder gerieben habe. Sie gehörten eben immer auch zum Paket. Umgekehrt haben meine gelegentlichen Flirts mit dem Prinzip der kreativen Zerstörung mehr als einmal Schweiß und Sorgenfalten auf Deiner gewissenhaften Stirn verursacht. Aber wir sind immer weiter gelaufen, haben immer weiter geredet und, wenn nötig, auch mal geschwiegen.
Apropos Abschied und Bewegung: Der geniale Songpoet Rich Mullins (er starb 1997 bei einem Autounfall), hat sich in einem seiner Lieder Gedanken über den Tod gemacht.
When I leave I want to go out like Elijah
With a whirlwind to fuel my chariot of fire
And when I look back on the stars
Well, it’ll be like a candlelight in Central Park
And it won’t break my heart to say goodbye
Elia, der alte Haudegen, dämmerte nicht etwa auf sein Ende hin, sondern wurde nach biblischer Darstellung mitten aus seinem turbulenten Wirken zum Himmel entrückt. Eine andere Zeile aus dem Text lautet:
On the road to salvation
I stick out my thumb and He gives me a ride
And His music is already falling on my ears
Was für Musik auch immer Dich vor Istriens Küste davongetragen hat, sie wird irgendwann auch uns endgültig trösten, wenn sie an unser Ohr dringt. Bis dahin halte ich es auch mit dem guten Rich, wenn er schreibt:
I’m here to tell you I’ll keep rocking, ‚til I’m sure it’s my time to roll.