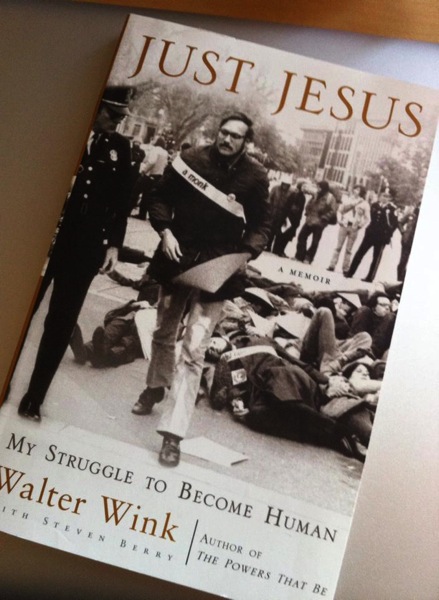Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes! (Offenbarung 19,1)
Danach
Nach den Schalen der Zorns,
nach dem siebenfachen Ton der Posaune,
nach dem Öffnen der Siegel
Nach Krieg, Zerstörung, Feuer und Gericht
Nach dem Sturz der Stadt, die den Erdkreis tyrannisiert hat
Nachdem die Geschäftemacher und Geldwäscher sich die Augen ausgeweint haben
Nach Verfolgungsjagden vom Himmel auf die Erde und wieder zurück
Nach Dramen mit Drachen und Monstern
Nach Flucht und Vertreibung
Nach Angst und Verblendung
Nach Charlie Hebdo und Boko Haram
nach Genoziden in Afrika und dem Nahen Osten, an Juden, Muslimen und Christen
nach brennenden Textilfabriken ohne Notausgang
nach Kindersoldaten und Genitalverstümmelung
nach verseuchtem Nigerdelta, verstrahltem Fukushima und verqualmtem Amazonasbecken
Nach Jahrhunderten von Krieg, Ausbeutung und Sklaverei
nach Zwangsbekehrungen zum jeweils rechtesten Glauben
nach Zensur der Wahrheit und Mord an den Propheten
nach Korruption, Opportunismus und Gleichgültigkeit derer, die etwas hätten ändern können
nach Jahrhunderten der Unterdrückung von Frauen, Arbeitern und Dissidenten
nach einer Ewigkeit von Egoismus und Verrat, Zerwürfnissen und bösen Worten
nach Lügen, Feigheit und Verzweiflung
Danach:
Ein Flashmob aus Märtyrern und Engeln, halbseidenen Heiligen und himmlischem Hofstaat
tanzt auf den Straßen, denn die Grenze zwischen Himmel und Erde wird gerade abgebaut
heute ist Berlin überall, die Checkpoint Charlies öffnen die Schranken,
die Invasion des Heils hat begonnen.
„Das tritt nach meiner Kenntnis… ist das sofort, unverzüglich“,
stottert ein überrumpelter Politiker
und der Versprecher des einen erfüllt das Versprechen des Dreieinen.
Ein großer Chor erhebt seine Stimme – eine Stimme – und stimmt das Lob des einen an.
Des einen, der jeden Schrei seiner Geschöpfe gehört, jeden Schmerz geteilt,
jedes Unrecht gehasst, jede Bosheit ertragen hat
dem jede beschmutzte Ehre und verletzte Würde heilig sind
Der sich an jede Grausamkeit erinnert, die die Welt verdrängt und vergessen hat
Der jeden vergessenen Namen noch weiß,
Der sich eine Fortsetzung ausgedacht hat
für jedes Leben, das zu früh zu Ende ging
der jede verschlagene Heimlichkeit
von den Dächern rufen lässt
Alle Lieder, die je gesungen wurden, münden in ein einziges großes Brausen
ein kosmisches Crescendo aus donnerndem Gewitter und rauschenden Sturzbächen
– vielleicht wie 1928 in Paris die tumultartige Uraufführung von Ravels berühmten Bolero
als eine Frau im überwältigten Publikum schockiert ausrief „Hilfe ein Verrückter!“
und der Komponist zur Antwort gab: „Die hat’s kapiert.“
Und nun gibt es, nach all dem Leid und all den düsteren Jahren
kein Halten mehr
für alle, die verrückt genug waren, an diese Verheißung zu glauben,
für alle, die kapiert haben,
dass es mit dem Heil der Welt ganz leise beginnt
dass ein Instrument zum anderen kommt
bis der Saal schließlich so voll Musik ist
dass du Herzrasen bekommst.
Und wir – sind dabei!
Das Brot wird endlich gerecht geteilt
der Wein fließt reichlich
die Tränen sind abgewischt
Die Versuchung hat jeden Reiz verloren
und der Kampf mit dem Bösen jeden Schrecken
der Tod sucht verzweifelt seinen Stachel.
Aus dem unscheinbaren Senfkorn,
dessen zarte Triebe tausendmal niedergetreten wurden,
ist ein großer Baum geworden
Die winzige Portion Sauerteig hat den ganzen Teig durchdrungen
Der Schatz ist ausgegraben
Die unbezahlbare Perle funkelt in allen Farben des Regenbogens
Das Netz ist eingeholt, den Fischern gehen die Augen über
und das Boot fast unter über der Menge des Fangs.
Und bis dahin?
Das Reich, von dessen Kommen Jesus in so vielen Bildern spricht,
ist unterwegs, aber noch nicht da
so lange Menschen aus Angst, Hass, Gier und Mutwillen aufeinander losgehen
so lange Trennungen und Spaltungen unsere Welt – und mit ihr die Kirche – zerreißen
Der Seher Johannes schaut zurück auf die Auferstehung
und sieht die Zukunft der Welt in ihrem Licht
Sein Ruf gilt der Märtyrerkirche, nicht dem Wohlstandschristentum:
Gott will, dass wir durchhalten statt zu resignieren oder faul und gleichgültig zu werden
Er ist Trost für die Pilger und Warnung an die Sesshaften und Etablierten
Er ist eine Einladung auf den Platz zwischen den Stühlen
nicht die „goldene Mitte“ perfekter Balance und kluger Vermessung
Sondern der Abgrund, über den die Geschosse fliegen und in dem Verwundete liegen.
Es ist ein Weckruf an alle Gemeinschaften, die dem Zeitgeist folgen, der sagt
„Die Welt ist mir zuviel, und ich selbst bin mir genug“.
An die Hobbit-Mentalität, die sich im behaglichen Beutelsend einrichtet
die dort Gleichgesinnte willkommen heißt und Fremden misstraut
und sich nicht zuständig fühlt für die Welt „da draußen“
Gott hat andere Interessen
als rein privates Glück.
Sein Reich
ist mehr als mein Reich und dein Reich
und sein Reich und ihr Reich.
Er wurde arm, damit wir reich werden
schreibt Paulus – nicht ohne Ironie – ins reiche Korinth
Er wurde schwach, um die Starken bloßzustellen
und wen er erwählt, den macht er auch schwach.
Denn sein Reich gehört den Ohnmächtigen
den Armen
den Sanftmütigen
den Trauernden
den Hungrigen und Durstigen
den Versöhnern und Friedensstiftern
* * *
Es war die Woche vor Pfingsten
Ich verbringe ein paar stille Tage im Frankenwald
Beim Morgengebet in einer Kapelle sprechen alle das Vaterunser
und während ich die letzte Zeile mitspreche
scheinen die Worte in mir zu explodieren
Die Luft vibriert und die Farben erscheinen in funkelndem Glanz
Als hätte jemand den Grauschleier über den Dingen weggezogen
Ein Rhythmus formt sich in meiner Seele
Denn Dein – ist das Reich – und die Kraft – und die Herrlichkeit
mit jeder Wiederholung wird er intensiver
(erging es ihnen beim Komponieren auch so, Maurice Ravel?)
Der Wind in den Bäumen und die Stimmen der Vögel
ist voller Harmonien zu dieser Melodie in meinem Kopf.
Eine unbändige Energie strömt durch meinen Leib
ich möchte aufstehen, tanzen, losrennen
„blindlings und absichtslos“ auf Gott zu.
Ein Panzer aus Jahrzehnten von Melancholie,
der sich so eng um meine Brust gelegt hatte, dass ich ihn für einen Teil von mir hielt,
wird von dieser Freude gesprengt.
Ich gehe hinaus in den singenden Wald, der Boden federt unter jedem Schritt
Sorgen, Traurigkeit, Ängste und Konflikte schrumpfen auf Normalmaß
Alles ist noch da:
Das Schöne und das Schmerzhafte,
heile und angespannte Beziehungen,
Bewältigtes und Unbewältigtes
aber nichts überwältigt mich mehr.
Ein Tisch ist mir gedeckt im Angesicht der Feinde.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen
Lebenslänglich.
Ich kann an diesen Platz
immer zurückkehren
Manchmal wird die Ahnung vom glücklichen Ende schon so stark, dass wir mutig werden
Dann stimmen wir das Lied der Erlösten an,
weil die Heimkehr in das Verheißene schon begonnen hat
weil Babylon, ob es am Hudson, der Themse, dem Jangtse oder am persischen Golf liegt
mit seinen Hotel- und Bankentürmen, Wellnessoasen und Nobelkarossen, Stars und Glamour
weniger Herrlichkeit hat als eine Lilie auf dem Feld.
Ohne Vorfreude geht nichts im geistlichen Leben.
Verbissen werden wir die Welt nicht verändern.
Das Danach verändert das Jetzt.
Es beginnt ganz leise.