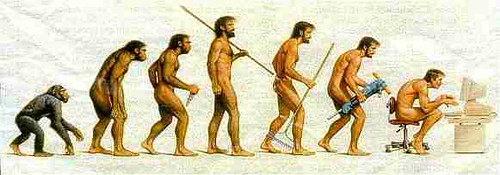Ich habe mich heute an einen Brief von D.H. Lawrence aus dem Jahr 1924 (!!) erinnert, den Walter Wink vor über 20 Jahren in seiner Powers-Trilogie zitierte. Beim Nachlesen fand ich ihn bemerkenswert prophetisch. Lawrence reiste (wie ich diese Woche) vom Elsass über den Rhein in den Schwarzwald und bemerkt eine ganz andere, bedrückende Atmosphäre im Land:
Deutschland, dieses Stück Deutschland, ist ganz anders als vor zweieinhalb Jahren, als ich hier war. Damals war es noch offen für Europa. Damals schaute es noch nach Westen, nach einer Einigung, einer Art Versöhnung. Das ist nun vorbei. Die unvermeidliche, mysteriöse Barriere ist wieder gefallen, und der germanische Geist neigt sich wieder nach Osten, nach Russland, […] Die Positivität unserer Zivilisation ist gebrochen.
… Aber nachts spürt man, wie sich seltsame Dinge regen in der Dunkelheit, seltsame Gefühle regen sich aus diesem immer noch nicht eroberten Schwarzwald. Du spannst den Rücken an und lauschst der Nacht. Man spürt die Gefahr. Es sind nicht die Leute. Sie wirken nicht gefährlich. Ein Gefühl der Gefahr liegt in der Luft, ein eigenartiges, scheuerndes Gefühl unheimlicher Gefahr. Etwas ist geschehen. Etwas ist geschehen, was noch nicht eingetreten ist. Der alte Zauber der alten Welt ist gebrochen und der alte, widerborstige, rohe Geist macht sich bemerkbar. […] Das, scheint mir, ist schon geschehen. Und es ist ein Geschehen mit einer weit tiefgreifenderen Wirkung als jedes konkrete Ereignis. Es ist der Vater der nächsten Phase von Ereignissen.
… Nicht, dass die Menschen tatsächlich etwas planen oder sich verschwören und auf etwas vorbereiten würden. Ich glaube das nicht eine Minute lang. Aber der menschlichen Seele ist etwas zugestoßen, gegen das es keine Hilfe gibt.
… Und es sieht aus, als würden sich die Jahre rasch zurückdrehen, nicht mehr weiter. Wie eine gebrochene Feder, die rasch zurückschnappt, so scheint sich die Zeit mit rätselhafter Geschwindigkeit auf eine Art Tod hin zu wirbeln.
… Es ist ein Schicksal; niemand vermag es mehr zu ändern. Es ist Schicksal. Selbst das Blut ändert sich. Innerhalb der letzten drei Jahre hat sich die Zusammensetzung des Blutes in den Venen Europas geändert. […] Gleichzeitig haben wir es über uns selbst gebracht – durch die Ruhrbesetzung, durch eine englische Untätigkeit und einen falschen deutschen Willen. Wir haben es selbst verursacht. Aber offenbar ließ es sich nicht abwenden.
Vielleicht waren Lawrences Zeitgenossen ja der Meinung, er höre das Gras wachsen. Man kann sich sicher auch viele kritische Gedanken zu seinem Geschichtsbild und den Klischees und Stereotypen darin machen (die betreffenden Passagen habe ich hier zum größten Teil ausgelassen). Auf jeden Fall muss man fragen, ob alles so unabwendbar war, wie Lawrence das empfand. Andererseits wissen wir, dass es solche Punkte gibt, an denen Bewegungen ins Unkontrollierbare kippen.
So oder so – die Tatsache, die schon Thomas Mann bewundert hatte, bleibt: Neun Jahre vor Hitlers Machtergreifung (1924 saß der noch in Landsberg ein) spürt Lawrence das Zerbrechen Europas und die Entfesselung einer gigantischen „Barbarei“ und kann es – poetisch, gewiss – in verständliche Worte fassen.
Heute, über 90 Jahre später, regen sich ähnliche Dinge. Der größte Unterschied zu damals ist vielleicht der, dass derzeit die Rechten in Ungarn und Frankreich, England und Österreich, Polen und den Niederlanden mindestens so stark sind wie die AfD. Ein Trost ist das freilich ganz und gar nicht. Lawrence hat das als eine „Rückkehr“ beschrieben, und so erleben wir das momentan ja auch. In letzter Zeit war Brechts berühmtes „der Schoß ist fruchtbar noch“ immer wieder zu lesen. Nur ist der Backlash heute eben nicht mehr auf Deutschland begrenzt. Die neue Barbarei droht überall. Kein Fortschritt ist unumkehrbar.
Welche Hoffnung haben wir dem entgegenzusetzen? Sind unsere westeuropäischen Demokratien (anders vielleicht als die eine oder andere osteuropäische) gefestigt genug, um sich in dieser zunehmend vergifteten Atmosphäre zu behaupten? Sein Brief enthält keine Anleitung, was zu tun wäre. Aber eine wichtige Einsicht über die Kultur Europas: Sie entstand aus der Mischung und Vermengung („fusion“) von germanischer und romanischer Bevölkerung, und es ist gerade die Vielfalt, die den Reichtum und die Größe ausmacht. Heute müssten wir auch das weiter fassen und die orientalischen Kulturen einbeziehen. Der Umkehrschluss lautet: Wer sich von diesem Zusammenfluss abwendet, wer das Andersartige fürchtet, dämonisiert und verachtet, der gerät in den Sog des Strudels roher, destruktiver Macht.