Es kommt wohl eher selten vor, dass ein Schüler mehr graue Haare hat als sein Mentor. In meinem Fall wird das so sein. Viele wissen es schon, dass ich ab dem ersten März bayerischer Vikar werde. Ich freue mich auf die Kirchengemeinde St. Leonhard-Schweinau im Westen von Nürnberg und auf Pfr. Dr. Gunnar Sinn, den ich vor einigen Wochen schon kurz kennengelernt habe. Zwischendurch werde ich immer wieder mal ein oder zwei Wochen im Predigerseminar in Nürnberg zubringen und vermutlich sind manche der Vikarskolleg*innen dort nicht wesentlich älter als meine Tochter. Aber es ist ja auch ein seltener Luxus, in dieser Lebensphase noch einmal alle wichtigen Fragen zu durchdenken, alte Kenntnisse aufzufrischen und professionelles Feedback zu bekommen. Schweinau ist ein Stadtteil, der mit seiner Sozialstruktur in vieler Hinsicht ein Kontrastprogramm zu Erlangen darstellt, da gibt es für mich eine Menge zu lernen und zu entdecken. Und während viele erst das Pflichtprogramm und dann die „Sonderformen“ von Gemeinde und Gottesdienst entdecken, läuft es bei mir nun eben umgekehrt. Mit vier Kindern in Studium und Berufsausbildung ist das kein ganz kleines Abenteuer.
Im Freundes- und Bekanntenkreis hat die Nachricht viel Zustimmung und positive Resonanz ausgelöst, aber auch ein paar nachdenkliche Fragen dazu, warum ich das mache und wie der Schritt zu deuten ist. Fangen wir doch beim Offensichtlichen an: Bei ELIA laufen die Dinge gut, das die Pionierphase liegt im 24. Jahr schon eine Weile hinter uns, und es hängt weniger an meiner Person, als manche(r) vielleicht vermutet. Dass es uns allen über 20 Jahre gelungen ist, ohne Zank oder Entfremdung gemeinsam älter zu werden, empfinde ich als ein echtes Wunder. Es gibt auch im Augenblick keine Konflikte, die über jene produktive Grundspannung hinausgehen, die bei so vielen Charakterköpfen und einer derart bunten Mischung an Prägungen und Frömmigkeitsstilen normal sind. Ein guter Zeitpunkt, um mich etwas zurückzunehmen, ohne ganz auszusteigen. Wir wohnen weiter in Erlangen, ich werde auch während des Vikariats regelmäßig bei ELIA predigen und andere Aufgaben übernehmen.
Vor 25 Jahren war ich schon einmal an diesem Punkt: Ich hatte eine Vikariatsstelle in Hof zugewiesen bekommen und die dann abgesagt, um mein Promotionsstudium anzupacken. Während dieser Zeit entstand dann ELIA, ohne dass ich das so geplant hatte, und ich stellte fest, dass mir die flexiblen Strukturen und die Spielräume zum Experimentieren sehr liegen. In einer solchen Gründungsphase kann man aber nicht nach zwei oder drei Jahren aussteigen, also lag die weitere kirchliche Laufbahn für unbestimmte Zeit auf Eis (der Computer im Landeskirchenamt führte mich als „Abbrecher“, aber so fühlte sich das von meiner Seite aus nicht an). Die Entscheidung für die Promotion und die Gemeingründung war nie eine Entscheidung gegen die Landeskirche (ebensowenig ist diese Entscheidung jetzt für das späte Vikariat eine Entscheidung gegen dies oder jenes – oder eben nur in dem Sinn, dass man nicht alles gleichzeitig machen kann, was gut und sinnvoll ist).
In den letzten Jahren entwickelte sich dieses Verhältnis sehr konstruktiv. Ich bekam eine Prädikantenbeauftragung, arbeitete in verschiedenen kirchlichen Arbeitsgruppen mit, nahm an Tagungen und Konferenzen teil, der Landesbischof besuchte die Gemeinde. Meine theologische Sprache und die Themen, mit denen ich mich beschäftige, haben sich in den letzten zehn Jahren noch einmal so kräftig wie konsequent weiterentwickelt. Ebenso die Spiritualität: Ich habe einen sehr positiven Zugang zu Liturgie gefunden. Insofern ist das Vikariat nun ein weiterer, logischer Schritt auf einem Weg der Konvergenz. Und wie die nächste Etappe dann in zweieinhalb Jahren aussieht, ist noch völlig offen. Aber bei allen Verantwortlichen, mit denen ich in den letzten Monaten über diese Entscheidung gesprochen habe, war der Wunsch spürbar, nach dem Vikariat auch einen Platz zu finden, an dem die Erfahrungen, die ich schon mitbringe, sinnvoll zur Geltung kommen können.
In den letzten Monaten habe ich, nicht immer ganz leichten Herzens, so viele Einladungen zu Kursen, Tagungen und Kongressen abgesagt wie noch nie, und mich aus verschiedenen Kreisen und Gremien ausgeklinkt, um Platz für das Neue zu schaffen. Wie viel Zeit mir zum Bloggen bleibt beim Pendeln ich die große Nachbarstadt und wie sich meine Themen und Perspektiven verschieben bei allem, was da neu auf mich zukommt und meine Aufmerksamkeit beansprucht, kann ich noch nicht abschätzen.
Erst einmal wird es bestimmt etwas ruhiger hier.
Es hat eben alles seine Zeit.




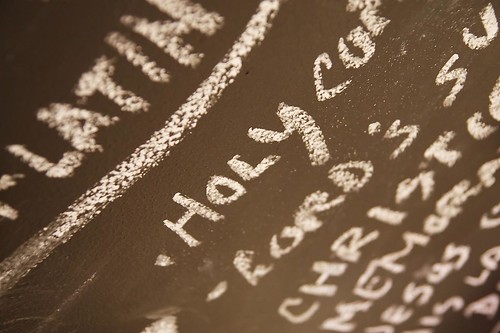



















 Dann erklärt er mir, dass auf der anderen Seite die Muslime seien und Juden nicht in die Moschee dürfen. Dass der Ausschluss umgekehrt auch gilt, hatte ich ja schon erlebt. Als ich vorsichtig andeute, dass ein Frieden zwischen den Lagern doch im Sinne aller wäre, winkt er ab. Ihr Christen und wir Juden sind friedlich, gibt er mir zu verstehen, aber die Muslime wollen uns alle töten. Ich widerspreche vorsichtig – die Muslime, dich ich bisher getroffen habe, sind friedliche Menschen, die auch viel erduldet haben. Dann wird es schwierig, seiner Antwort sprachlich zu folgen, denn er setzt zu einem Redeschwall an. So viel habe ich dann doch verstanden: Wenn die Palästinenser aus dem Gazastreifen eine Rakete auf uns schießen, dann schießen wir zehn oder hundert zurück. Und dann ist es uns egal, ob und wie viele Frauen und Kinder dort sterben.
Dann erklärt er mir, dass auf der anderen Seite die Muslime seien und Juden nicht in die Moschee dürfen. Dass der Ausschluss umgekehrt auch gilt, hatte ich ja schon erlebt. Als ich vorsichtig andeute, dass ein Frieden zwischen den Lagern doch im Sinne aller wäre, winkt er ab. Ihr Christen und wir Juden sind friedlich, gibt er mir zu verstehen, aber die Muslime wollen uns alle töten. Ich widerspreche vorsichtig – die Muslime, dich ich bisher getroffen habe, sind friedliche Menschen, die auch viel erduldet haben. Dann wird es schwierig, seiner Antwort sprachlich zu folgen, denn er setzt zu einem Redeschwall an. So viel habe ich dann doch verstanden: Wenn die Palästinenser aus dem Gazastreifen eine Rakete auf uns schießen, dann schießen wir zehn oder hundert zurück. Und dann ist es uns egal, ob und wie viele Frauen und Kinder dort sterben.
