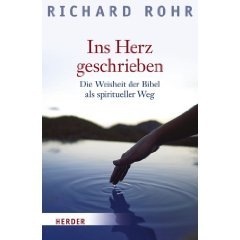Im Rahmen einer Fortbildung habe ich am letzten Sonntag einen – durchaus gut gestalteten – agendarischen Gottesdienst besucht. Es war eine eigentümliche Mischung aus Befremden und Wiedererkennen für mich. Und nachdem ich hier schon vor längerer Zeit einmal die Frage gestellt hatte, was eigentlich unsere Liturgie „predigt“, war diesmal mein Gesamteindruck der, dass hier ein sehr starker und – jetzt lehne ich mich aus dem Fenster – auch recht einseitiger Akzent auf Schuld und Vergebung zu spüren war, der von den Chorälen noch unterstrichen wurde.
Dagegen erscheint das Heil in den Formulierungen tendenziell doch eher als etwas zukünftig-jenseitiges, es wird daher erbeten und verheißen, aber nicht so richtig gefeiert und genossen. Zwei Aspekte, die völlig untergehen, sind das Wachsen im Glauben (der Pietismus würden hier von „Heiligung“ reden) und die Sendung der Christen in die Welt (es sei denn, dass man letzteres mit dem Schlusssegen als abgehakt betrachtet).
Dass heute viele Menschen ihre Mühe mit diesem Thema Schuld/Sühne/Vergebung haben, mag nicht nur mit dem Traditionsabbruch und fehlenden Zugängen zu tun haben, sondern auch mit der Überdosis dieses Aspektes, die sich über Generationen angesammelt hat, und die nun an manchen Stellen dazu führt, dass man das Kind mit dem Bad ausschütten will. Aber mein subjektives Empfinden beim Durchgang durch die Liturgie war eben auch, dass sich die Beschreibungen der Liebe Gottes weitgehend darin erschöpfen, dass er barmherzig ist und auf Strafe verzichtet.
Man könnte also sagen, dass von den drei Wegen der Spiritualität – purgatio, illuminatio und unio – nur der erste explizit thematisiert und eingeübt wird. Natürlich kann man mit einem einzigen Gottesdienst nie alles unterbringen. Trotzdem – im Evangelium steckt mehr, als diese Gottesdienstform vermuten ließe.