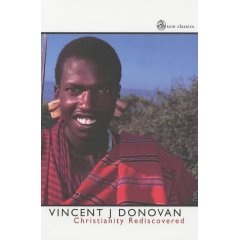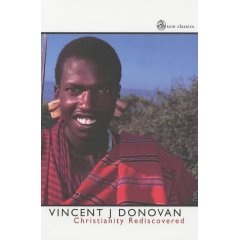Diese Allianz-Gebetswoche steckt voller theologischer Zumut… äh, Herausforderungen. Zum Beispiel der Abschnitt für heute: Wie hier die Bibel mit der Bibel umgeht, ist schon sehr interessant. In Hebräer 11,17-19 wird die Geschichte von Isaaks Opferung als Hinweis auf die Auferstehung Christi gelesen. Abraham, heißt es da, glaubte an die Auferweckung und konnte deshalb seinen Sohn opfern. Wenn das so war, dann konnte Abraham diese Hoffnung lange geheim halten, denn im gesamten Alten Testament findet sich davon kaum eine Spur. Im Gegenteil – tot ist tot, Punkt. Die ganze Spannung der Erzählung in Genesis 22 rührt ja daher, dass der Tod unwiderruflich ist. Den Autor des Hebräerbriefes hält das aber nicht davon ab, den Text völlig gegen den Strich zu bürsten: Abraham glaubte, dass Isaaks Tod nicht der Tod der Verheißung sein würde. Im Unterschied zu Hiob bekam er ihn deshalb auch gleich zurück, das heißt, er musste ihn gar nicht erst richtig hergeben.
Dieser Abraham taugt nur sehr bedingt als Identifikationsfigur für Menschen, die gerade einen schweren Verlust erlitten und ihre Hoffnung verloren haben. Aber es geht hier auch gar nicht um den Umgang mit Leid, sondern das unerschütterliche Vertrauen auf Gottes Zusagen, für die selbst der Tod keine unüberwindliche Grenze mehr darstellt. Uns wird Abraham als jemand vor Augen gestellt, der auf die Auferstehung hofft. Wir, das macht der Hebräerbrief auch klar, blicken auf den Beginn der Erfüllung dieser Verheißung schon zurück, die Auferweckung Christi – unsere eigene steht trotzdem noch aus, deshalb leben auch wir im Glauben. So wie Abraham sind auch wir auf einer Pilgerreise unterwegs und noch nicht am Ziel angekommen.
Der christologische Bogen wird hier also über die Auferstehung geschlagen, und gerade nicht über das Opfer, das in Publikationen der Allianz allerdings so sehr zum Standardrepertoire gehört, dass es auch hier in der gewohnten Terminologie erscheint, die durch den Versuch, ein bisschen modern zu wirken, hart an der Banalität entlangschrammt: „Er opfert seinen Sohn, damit wir leben können. Für uns ist es „kostenlos“, denn den Preis hat Gott selbst bezahlt.“ (Gut, wenigstens war es nur „kostenlos“, nicht umsonst…)
Aber Glaube ist eben keine kostenlose Sache, weder bei Abraham noch bei uns. Die „Zeugen“ aus Hebräer 11 hat ihr Glaube einiges gekostet. Für uns bedeutet es zumindest, mit leichtem Gepäck (vgl. 12,1) unterwegs zu sein. Paulus, selbst immer für eine kreative Neuinterpretation der Abrahamsgeschichte gut, redet in einem anderen Zusammenhang (1. Kor 7,29ff) davon, dass wir alles im Leben ohne Besitzanspruch nur als vorläufig behandeln und so mit Mangel wie mit Überfluss richtig umgehen können (Phil 4,12-13). Schließlich erinnert die Bitte um das tägliche Brot im Vaterunser an Sprüche 30,8, hebräische Weisheit ist auch angesichts der von Gier verursachten Finanzkrise topaktuell: „Gib mir weder Armut noch Reichtum, nähr mich mit dem Brot, das mir nötig ist, damit ich nicht, satt geworden, dich verleugne und sage: Wer ist denn der Herr?, damit ich nicht als Armer zum Dieb werde und mich am Namen meines Gottes vergreife.“
Dafür ist Abraham ein Vorbild. Vincent Donovan hat es im Blick auf die Christen unter den Massai später so formuliert:
hat es im Blick auf die Christen unter den Massai später so formuliert:
Diese Nomaden hatten keine Kirchengebäude, keine Tempel, keine Tabernakel. Sogar ihre Eucharistie war eine nomadische Eucharistie gewesen, immer in Bewegung, nie stationär, nie statisch. Und die Kirche war für sie genauso. Die einzige Kirche, die sie je gesehen hatten, die einzige Kirche, die sie kannten, war eine Kirche die beständig in Bewegung war, eine mobile Kirche, eine nomadische Kirche, eine Kirche, die nie vollkommen war, nie am Ende angekommen war, nie alle Antworten hatte, nie zur Ruhe kam – eine Kirche auf Safari. Für sie würde es immer eine Pilgerkirche sein.