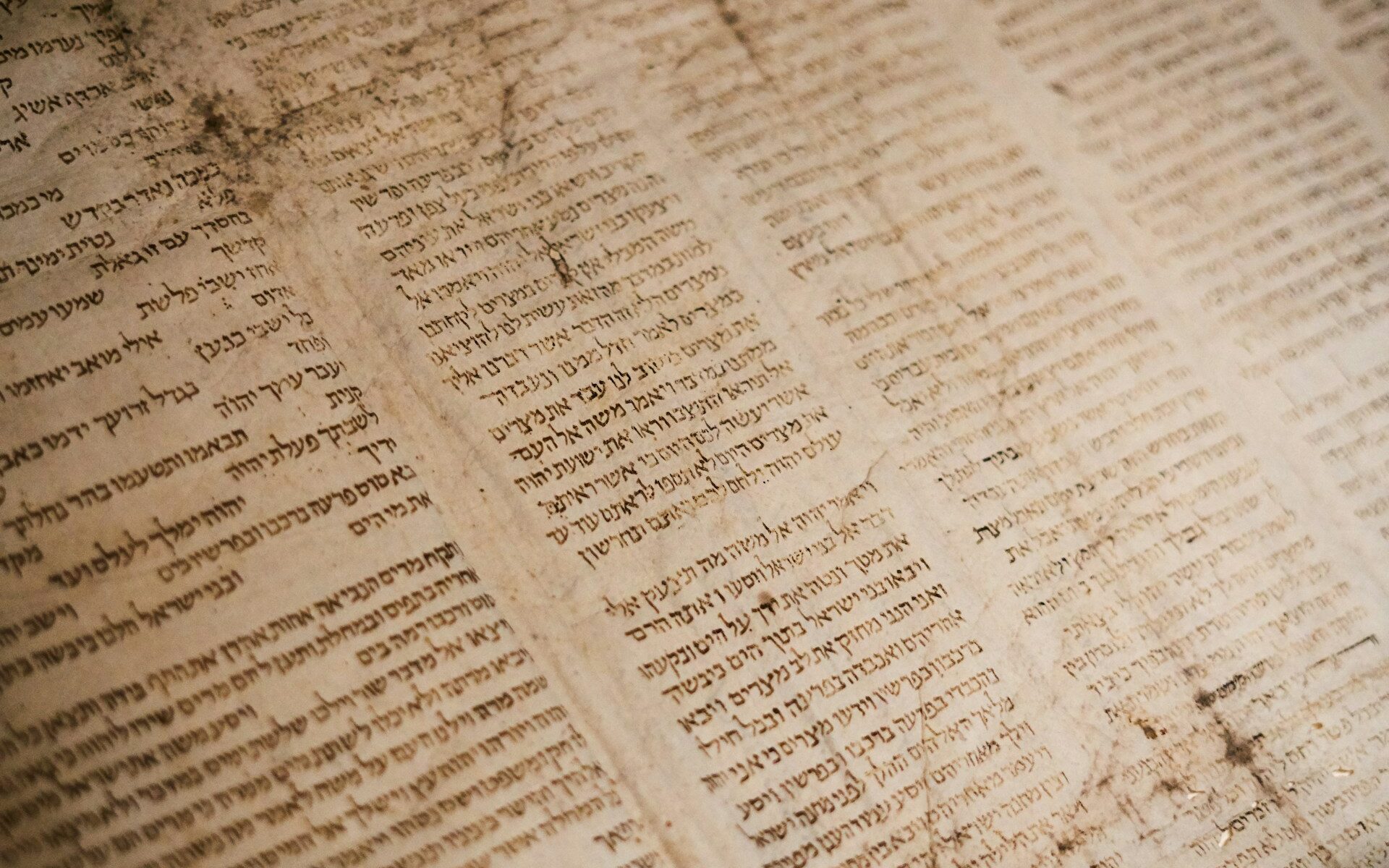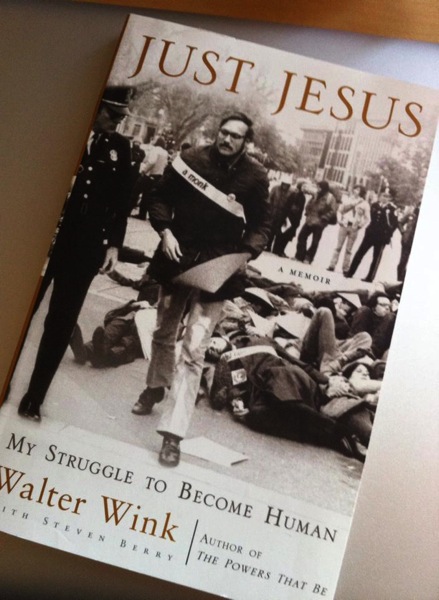An einem nieseligen Sonntagnachmittag warte ich vor der Nürnberger Lorenzkirche. Da höre ich, wie sich knapp hinter mir ein Schwall Wasser geräuschvoll auf das Pflaster ergießt. Ich springe zur Seite und blicke nach oben. Hoch über mir reißt ein grimmig dreinblickendes Wesen aus Stein sein Maul auf: Ein Wasserspeier, wie er an vielen mittelalterlichen Kirchen zu finden ist.
Die Steinmetze hatten ganz offensichtlich ihren Spaß an den finsteren Gestalten. Drinnen in der Kirche, auf den Altären und in den Fenstern, sind Heilige und Szenen aus der Bibel abgebildet. Für böse Geister gilt also: „Wir müssen draußen bleiben.“ Da aber haben sie ihren Platz: Als Erinnerung daran, dass in dieser Welt nicht nur gute Kräfte am Werk sind. Und vielleicht auch daran, dass wir nicht immer alles verstehen und einordnen können, was um uns herum passiert.
Diese Faszination für skurrile Fratzen und Fabelwesen begegnet uns heute eher in der den Fantasy-Welten von Harry Potter über den Herrn der Ringe bis zu Game of Thrones. Und in Horrorfilmen wie „der Exorzist“, oder Action-Klamauk á la „Ghostbusters“, der in diesem Monat vor genau 40 Jahren ins Kino kam. If there’s something strange in the neighborhood – wenn in der Nachbarschaft komische Sachen passieren, dann holt man diese Kammerjäger fürs Paranormale. Statt Kakerlaken entfernen sie mit ordentlichem Getöse lästigen Spuk. Geister, die kein Wasser speien, aber ekligen Schleim hinterlassen. Und die verschreckten Kunden können wieder aufatmen und sich sagen: „I ain’t afraid of no ghost – ich hab keine Angst nicht vor Geistern“.
Auf der Leinwand und zwischen den Buchseiten haben Geister und Dämonen an den Rändern unseres aufgeklärten Denkens überlebt. Draußen statt drinnen, ordentlich aufgeräumt, dürfen sie sie ihr Maul aufreißen wie die Wasserspeier an alten Kirchen. Ein bisschen Gruseln ist ganz nett.
Da kann man nichts machen…?
Ganz so aufgeräumt ist die Welt freilich nicht. Denn die konkrete Erfahrung, dass es zerstörerische Kräfte gibt, oder Orte mit einer bedrückenden Atmosphäre, das kenne ich ja auch. Momente, in denen ich mich ganz bewusst dagegen stemmen muss, um nicht von Angst und Hoffnungslosigkeit überwältigt zu werden. Und ich höre, wie andere vom „Ungeist“ des erstarkenden Rechtsextremismus reden. Oder von den „Dämonen der Vergangenheit“, wenn Rassisten aufmarschieren und Nazi-Parolen auf Partys gegrölt werden. Dämonen, das ist und bleibt ein schillernder Begriff. Offenbar aber einer, auf den wir nicht ganz verzichten können, wenn wir darüber reden wollen, wie es uns hin und wieder ergeht.
Wenn die Bibel von Dämonen erzählt, dann handeln diese Geschichten immer von Menschen, die sich als hilflos und ohnmächtig erleben und von etwas scheinbar Übermächtigem bedroht werden. So wie in dieser Episode aus dem Markusevangelium, in der Jesus mit seinen Jüngern den See Genezareth überquert und im Gebiet der „Zehn Städte“ landet. Die Leute dort sind keine Juden. Sie sprechen Griechisch und verehren die Götter der Griechen. Aber manche Probleme gleichen sich hüben wie drüben.
Und sie kamen ans andre Ufer des Sees in die Gegend der Gerasener. Und als Jesus aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist, der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten; denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben; und niemand konnte ihn bändigen. Und er war allezeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah von ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott: Quäle mich nicht! Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen!
Jesus begegnet einem Menschen, der außer Rand und Band ist. Er lebt abseits der Stadt, vor allem aber gefährdet und verletzt er sich ständig selbst. Die Leute haben vor ihm Angst und wissen sich nicht anders zu helfen, als ihn zu fesseln. Sie bekommen ihn allerdings nicht so recht in den Griff. Vielleicht haben sie auch ein schlechtes Gewissen; jedenfalls sind die Stricke und Fesseln locker genug, dass er sich immer wieder befreien kann. Resignation macht sich breit: Wir haben alles versucht, nichts hat geholfen.
„Besessenheit“ und Besatzung
Der Mann bei den Grabhöhlen scheint nicht zu wollen, dass andere ihm nahekommen. Aber Jesus tut genau das: Kaum setzt er – vom jüdischen Ufer des Sees kommend – seinen Fuß auf heidnischen Boden, kommt Bewegung in die festgefahrene Situation. Unwiderstehlich zieht es den Mann zu Jesus hin. Oder wird er von dem bösen Geist getrieben? Es klingt fast so! Und Jesus? Der wirkt kein bisschen überrascht. Er scheint gespürt zu haben, dass da unheilvolle Kräfte wirken, die er mit seiner Ankunft aufscheucht. Jesus fragt seelenruhig:
Wie heißt du? Und er sprach: Legion heiße ich; denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe.
Der kurze Wortwechsel ist aufschlussreich:
Die Dämonen geben sich als „Legion“ zu erkennen. Also die militärische Formation, mit der das römische Imperium seine knallharte Besatzungspolitik durchsetzt in dieser unruhigen Region. Gerasa war ursprünglich eine Ansiedlung mazedonischer Kriegsveteranen durch Alexander den Großen und seine Nachfolger. Und tatsächlich ist auch zu der Zeit, als Markus sein Evangelium niederschrieb, ganz in der Nähe eine Legion stationiert. Wirtschaftlich und psychisch ist das eine riesige Belastung für die einfachen Leute. Liebend gern hätten sie die Soldaten aus der Gegend vertrieben. Zwischen „Besessenheit“ und „Besatzung“ besteht offenbar ein Zusammenhang.
Und der Mann, aus dem die Geisterarmee gerade zu sprechen scheint, ist keineswegs der einzige Betroffene. In seiner Person verdichten sich sämtliche Ohnmachtsgefühle der ganzen Umgebung, von allen, die hier leben. Manchmal kann halt nur einer, der sich wie ein Verrückter benimmt, ungestraft den Wahnsinn aussprechen, den alle tagein, tagaus erleben.
Im Neuen Testament ist viel häufiger von Dämonen die Rede als im Ersten Testament, der hebräischen Bibel. Die stammt überwiegend aus der Zeit, in der Israel nicht besetzt war, sondern eigenständig. Es war für mich ein echtes Aha-Erlebnis, als ich auf Berichte aus der Kolonialzeit in Afrika aufmerksam wurde. Dort häuften sich mit dem Eindringen der Europäer die Fälle von Menschen, die unter Dämonen litten. Oft trugen die Geister Namen, die mit den Besatzern zu tun hatten. Manche imitierten das Geräusch einer Lokomotive. Und umgekehrt verwendeten die Heilkundigen Motoröl, Konservendosen oder Weißbrot, um die Geister fernzuhalten oder zu besänftigen: Typische Gegenstände jener Kultur, die ihre eigene bedrohte.
Jedes gewaltsame Aufbegehren gegen die reale Besatzung wäre glatter Selbstmord gewesen. Und jedes friedliche wurde gewaltsam niedergeschlagen. Im Scheingefecht mit den Dämonen war die Ohnmacht vorübergehend aufgehoben. Eine tödliche Eskalation äußerer Gewalt war trotzdem nicht zu befürchten.
Die Dämonen, auf die Jesus hier trifft, sind also keine paranormalen Spukphänomene, und auch keine wüsten Poltergeister wie bei Ghostbusters. Sie sind keine immateriellen Kobolde oder spirituellen Parasiten, die man sich wie Zecken oder Fußpilz irgendwo einfängt. Es geht auch nicht um die Seelen Verstorbener, die keine Ruhe finden und deshalb die Lebenden heimsuchen. In der Ein-Mann-Legion spiegelt sich vielmehr jener Teil der Wirklichkeit, den alle am liebsten vergessen und ausblenden würden: Das Ausgeliefertsein an fremde Eindringlinge, die Einschüchterungen und Demütigungen, die Angst vor Willkür und Gewalt, die angestaute Wut über die eigene Schwäche und der verzweifelte Hass auf die Warlords/Kriegstreiber und ihre Handlanger.
„Wenn du dich so machtlos fühlst, was wirst du dann tun?“, fragt Nelly Furtado. Sie fragt das als Kind von Einwanderern aus den Azoren. Soll sie sich an die weiße Mehrheit in Kanada anpassen, ihre Fotos retuschieren lassen und damit ihre Herkunft ausradieren? Oder riskiert sie, als fremd und störend ausgegrenzt zu werden – von einer Gesellschaft, die es sich noch immer nicht abgewöhnt hat, nicht-weiße Menschen als „Wilde“ zu betrachten. Dafür, findet sie, ist das Leben zu kurz.
Und plötzlich eskaliert das Ganze…
Zum Glück nicht: Mit dem Augenblick der Wahrheit über die „Legion“, die ihm so zusetzt, geht die Action erst richtig los. Und für einen kurzen Augenblick erinnert die Szene doch an Ghostbusters, wenn es da (Landwirte und Tierschützerinnen bitte kurz weghören) heißt:
Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen: Lass uns in die Säue fahren! Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue, und die Herde stürmte den Abhang hinunter ins Meer, etwa zweitausend, und sie ersoffen im Meer. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande. Und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er dasaß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte; und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war und das von den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen.
Die „Legion“ verhandelt wie eine echte Armee über ihren Abzug. Oder besser: Nicht-Abzug. Die Dämonen möchten nämlich in der Gegend bleiben. Sie bieten an, in ein anderes „Quartier“ umzuziehen – beziehungsweise, das trifft es wohl besser, ihre derzeitige Geisel gegen andere einzutauschen. Schweine gelten für Juden als unrein, vielleicht ist ja der Rabbi aus Nazareth bereit, sich auf einen Deal zu einzulassen?
Und tatsächlich – Jesus stimmt zu. Doch im nächsten Moment zerschlägt sich schon jede Hoffnung, ungeschoren davonzukommen: Hat Jesus es geahnt, hat er es vielleicht so geplant, oder passiert das alles spontan – wir erfahren es nicht. Wir lesen nur, dass die Schweine prompt den Hügel hinunterrasen und im Wasser untergehen. Die Geisterarmee versenkt sich selbst auf ihrer Flucht nach Westen.
Nach Westen, und das ist kein Zufall. Von Westen über das Meer kamen nämlich die römischen Schiffe, die Soldaten brachten und den größten Teil dessen mitnahmen, was Land und Leute erwirtschaftet hatten. Viele Menschen in der Region – Juden wie Griechen – hätten die Besatzer liebend gern nach Westen ins Meer zurückgedrängt. Und jetzt spielt sich genau das vor ihrer Nase ab, nur dass keine Menschen zu Schaden kommen. Zweitausend Schweine, das sind eine gewaltige Herde. Nicht ganz so viele, wie eine römische Legion Soldaten hat, aber die Richtung stimmt, und darauf kommt es an. Das ist mehr als ein Scheingefecht. Es ist ein Paukenschlag für die Freiheit, der weit ins Land hinein zu hören ist.
Schon einmal hat ein jüdischer Prophet eine Armee im Meer untergehen lassen. Aber an den Showdown zwischen Mose und den Ägyptern am Schilfmeer denkt im Augenblick nicht jeder. Denn alle staunen, dass der „Besessene“ plötzlich wie ausgewechselt erscheint: Er ist anständig gekleidet, seine Stimmung ausgeglichen, die Kontrollverluste überstanden.
Er ist sogar ganz erschreckend normal!
Freiheit, die nicht alle freut
Das kleine Drama weckt bei dem Umstehenden die Neugier und verursacht zugleich eine Menge Unbehagen. Es bleibt auch unklar, ob das Unbehagen eher dem Verlust der Schweine zuzuschreiben ist oder der Veränderung des Mannes, mit dem die Dämonen ihr böses Spiel getrieben hatten. Vielleicht wissen die Menschen es selbst nicht. Mit der veränderten Lage tut sich für sie ein Problem auf: Solange da ein „Besessener“ herumläuft, kann man sich daran abarbeiten. Oder sich daran gewöhnen und irgendwie damit arrangieren. So oder so braucht man keine Fragen zu stellen, auf die man die Antwort gar nicht wissen will.
In der Familientherapie ist das ein bekanntes Phänomen. In dysfunktionalen Familien, wo Menschen nicht miteinander klar kommen und einander immer wieder verletzen, gibt es oft ein „schwarzes Schaf“. Ein Familienmitglied, das sich auffällig verhält und auf das alle zeigen, wenn es um die Probleme im Miteinander geht. Es ist aber nur der Symptomträger, und nicht der Hauptverursacher der bestehenden Probleme. Das ist oft die einzige Person, die nicht am Rad dreht. Jesus hat das Schwarze Schaf aus seiner Rolle entlassen. Und plötzlich kriegen alle anderen die Krise.
Die Situation erinnert ein bisschen an jenen alten Witz von dem Betrunkenen, der im Lichtkegel einer Straßenlaterne seinen Haustürschlüssel sucht. Eine Nachbarin kommt vorbei und hilft suchen. Nach einer Weile fragt sie: „Bist du sicher, dass du den Schlüssel hier verloren hast?“ Er antwortet: „Nein, da hinten. Aber da ist es viel zu dunkel.“
Den Symptomträger in eine Klinik zu stecken, ihn mit Medikamenten ruhigzustellen, während alles bleibt, wie es ist, das wäre so eine Schlüsselsuche unter der Laterne. Ihn im desolaten Zustand bei den Gräbern hausen zu lassen, auch. Aber das geht jetzt nicht mehr. Nicht, so lange Jesus da ist. Und ich merke: Kein Wunder, dass nicht nur die Schweinehirten möchten, dass er verschwindet. Der Schlüssel zur Lösung ihrer Probleme liegt im dämonischen Dunkel ihrer Ängste und Albträume. Da wird man ganz schnell überwältigt.
Es sei denn…
Kleine Aufstände allenthalben
Es sei denn, die Gerasener könnten in dem ganzen Tumult auch erkennen, dass sich das un- und übermenschliche Böse gerade selbst zerstört hat. Dass im Untergang der Schweinelegion sogar schon der Untergang der römischen Militärdiktatur durchschimmert. Dass da schon jemand im Namen Gottes unterwegs ist, der ganz erstaunlich furchtlos und handlungsfähig ist, und der Menschen aus ihrer Ohnmacht und Verzweiflung herausholt.
Wir leben derzeit zum Glück nicht unter fremder Besatzung oder in einer Diktatur. Ohnmachtsgefühle und alles, was sie begleitet, kennen wir trotzdem. Sie entstehen bei uns durch Probleme, die wir als einzelne lösen sollen, obwohl sie viel zu groß sind für jede und jeden einzelnen:
- Wenn durch Inflation und Spekulation die Mietpreise explodieren und die Armut zunimmt, ist Obdachlosigkeit nicht einfach nur das Problem einzelner, die irgendwie versagt haben.
- Die Klimakrise trifft die am härtesten, die am wenigsten dafür können. Egal wie radikal ich meinen persönlichen Konsum ändere, es reicht noch lange nicht aus, um sie zu stoppen.
- Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt von Männern werden, erleben diese Übergriffe als etwas ganz Persönliches und Intimes. Es dauert oft lange, bis sie aufhören, den Fehler bei sich selbst zu suchen. Bis sie Worte finden für das, was ihnen angetan wurde. Erst dann zeigt sich: Nicht nur ein paar wenige sind betroffen. Und die Täter finden immer wieder Wege, ihre Schuld zu verschleiern, weil es Denkmuster und Machtkonstellationen gibt, die das fördern und begünstigen. (Auch in unserer Kirche.)
Wenn die Autor:innen der Bibel von Dämonen erzählen, dann zeigt es, wie ernst sie die Schadensmächte nehmen, die Menschen anfallen. Die sie so lange drangsalieren, bis sie sich nicht mehr vorstellen können, dass sich etwas ändert – bis ihnen die Kraft abhanden kommt, sich zu wehren. Das sind keine bloßen Wahnvorstellungen, kein primitiver Aberglaube, und wer so empfindet, ist nicht verrückter als alle anderen.
Diese krasse Geschichte tut mir richtig gut. Ich staune erleichtert darüber, wie das Böse, das manchmal so übermächtig auftrumpft, sich selbst zerstört. Gegen die Resignation ist also doch ein Kraut gewachsen: Gott selbst hat den destruktiven Mächten und Gewalten dieser Welt den Kampf angesagt. Er hat sich in Jesus auf die Seite der Ohnmächtigen und Traumatisierten geschlagen. Er erleidet am Kreuz dieselbe brutale Gewalt wie sie. Aber er zerbricht nicht daran. Er kommt mit dem verlorenen Schlüssel in der Hand aus der tiefsten Dunkelheit zurück und schließt die Tür zur Freiheit auf. Am Ende seines Evangeliums erzählt Markus die verrückteste Geschichte von allen: Vom leeren Grab. Und deutet damit an: Niemand ist jetzt vor Jesus mehr sicher. Er könnte wer weiß wo auftauchen…
Denn so wie der irdische Jesus auf Schritt und Tritt kleine, gewaltlose Aufstände vom Zaun gebrochen hat, so tut der Auferstandene das nun überall da, wo sich Menschen auf ihn einlassen und mit ihm zusammentun. Da endet die Machtlosigkeit und die Isolation. Da geht was. Und manchmal, manchmal auch ein bisschen mehr.
Die Jars of Clay singen davon, dass hoffnungslose Fälle Gottes Spezialität sind. Und dass Gott Menschen Kraft und Mut schenkt, sich einzumischen: „Small rebellions… Gib uns Tage, die voller kleiner Aufstände sind. Mutwillige, wüste Akte der Freundlichkeit von uns allen. Wir stemmen uns gegen den Strom (und den Verfall).
Und am Ende singen sie: We will never walk alone.
(Foto von Claudio Mota auf unsplash.com)