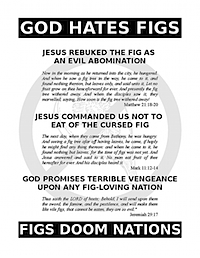Tomas Halik will Verständnis und Interesse für Distanzierte und kirchliche Randsiedler wecken. Jesus hat nicht nur den harten Kern seiner wandernden Jüngerschar gepflegt, sondern er ließ sich auch auf Begegnungen mit Leuten wie Zachäus oder Nikodemus ein, ohne diese von ihrem Ort wegzurufen. Auch die Diskussionen um Begriffe wie „Bekehrung“ im Pietismus zeigen: Gerade die ganz entschiedenen Jesusnachfolger könnten dem Irrtum erliegen, dass es nur eine mögliche Form des Christseins gibt – ihre natürlich. Aber gerade die Offenheit am Rande ist wichtig für unsere Gemeinden:
Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Kirche und Sekte liegt darin, dass sich eine auf den „harten Kern“ völlig identifizierter Mitglieder einschränkt, ggf. in diesem Mitgliedertyp das Ideal sieht. Die Kirchen sind in der Regel älter, weiser, erfahrener und großzügiger; sie wissen, dass sie außer dem „harten Kern“, dem Skelett, auch einen etwas elastischeren Leib brauchen (und dass es eine Beeinträchtigung darstellt, wenn der Körper durch eine übertriebene Diät unterernährt ist). Darüber hinaus gibt es in ihnen häufig Menschen, die wissen, dass der Begriff Rand und Mitte in einem Organismus, wie die Kirche einer ist, ziemlich relativ sein kann.
… Wenn ich manche Katholiken beobachte, mit welcher Lust sie die Pluralität der Kirche gemäß ihrem oft sehr eigenartigen Konzept von Katholizismus gerne streng disziplinieren würden, werde ich traurig darüber, wie diese „Eiferer für das Haus des Herrn“ überhaupt nicht begreifen, dass sie eigentlich gefährliche Attentäter sind, die eine der vitalsten Funktionen der Kirche bedrohen, ihre Katholizität – die Allgemeinheit, welche übrigens das Ideal aller christlichen, das Apostolische Glaubensbekenntnis betenden Kirchen sein sollte.